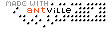Heute in der taz: Mein Artikel zum Schnapszahlgeburtstag von TeBe (inkl. Neukölln, Samantha Fox, Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Werner Enke, vier Bier, einem Mexikaner und einem Sauren):
http://www.taz.de/!114358/
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Seit rund zwanzig Jahren arbeite ich jetzt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk – für Fritz, die Jugendwelle des rbb, jüngst für Radio Eins, ein bisschen fürs rbb-Fernsehen. Doch noch nie habe ich den Satz „Und dafür zahle ich GEZ!“ so häufig gehört wie in letzter Zeit, vorgetragen mit dem Impetus der Empörung.
Eine Comedy, die jemand nicht lustig findet? – Und dafür zahle ich GEZ!
Ein Interviewpartner, der die falsche Meinung vertritt? – Und dafür zahle ich GEZ!
Ein Talkthema, das sich nicht mit dem Übel der Welt befasst? – Und dafür zahle ich GEZ!
Nun könnte man ausrechnen, wie viel einen Hörer so eine zweiminütige Comedy kostet (selbst wenn er nur einen Sender hört und kein Fernsehen sieht, sind das 0,00083 Cent). Doch die bessere Antwort lautet: „Ja, genau dafür!“
Denn der Rundfunkbeitrag ist ein Beitrag zur Medienvielfalt, und dazu gehört es, Dinge auszuhalten, die einem nicht gefallen. Gerade dafür zahlt man das Geld! (In den guten, alten Zeiten, als es noch keine Privatsender gab es, war es übrigens viel selbstverständlicher, Inhalte auszuhalten, die nicht den eigenen Interessen entsprechen.) Im Übrigen wage ich die Behauptung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für jeden etwas im Angebot hat, das ihm halbwegs entspricht. Allein in Berlin gibt es sechs öffentlich-rechtliche Radiosender, die über Antenne zu empfangen sind, sowie mit Deutschlandradio und Deutschlandfunk zwei bundesweite Programme. Im Fernsehen gibt es neben dem Ersten, dem ZDF und den Dritten Programmen jeweils drei Digitalkanäle sowie drei Gemeinschaftsprogramme: Auf Arte kann man anspruchsvolle Spielfilme und Dokumentationen sehen, auf Phoenix Bundestagsdebatten verfolgen, bei ZDF Neo gibt es gutgemachte Serien und bei Eins Festival Konzertmitschnitte. Das alles für den Preis von zwei Kinokarten im Monat.
Für die beiden Hauptsender scheint zu gelten: Wie man‘s macht, macht man‘s falsch. Bei quotenträchtigen Sendungen kommt der Vorwurf, den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag nicht zu erfüllen; bei Sendungen mit weniger Resonanz, am Gebührenzahler vorbeizusenden. Dabei verhält es sich mit dem Fernsehen wie mit der Mischkalkulation eines Verlags, der anspruchsvolle Literatur und Bestseller mischt: Vollprogramme wie das Erste und das ZDF funktionieren eben nur mit der richtigen Mischung. Tagesschau, Politmagazine oder Dokumentationen erreichen ihr Publikum nur, wenn sie eingebettet sind in ein zuschauerträchtiges Programm.
Natürlich gilt es trotzdem, einiges zu hinterfragen: Müssen wirklich so viel Gebührengelder in die Übertragung von Sportveranstaltungen fließen? Muss der Vorabend aus klischeebeladenen Telenovelas, Serien und Boulevardmagazinen bestehen? Braucht das Erste tatsächlich fünf Talkshows? Problematisch sind allerdings eher ein paar andere Dinge – zum Beispiel die Blüten, die die Bürokratie in so großen Behörden manchmal treibt, oder der Umgang mit freien Mitarbeitern in einigen Häusern.
Doch häufig genug steht hinter dem Satz „Und dafür zahle ich GEZ!“ gar nicht die inhaltliche Auseinandersetzung mit einzelnen Sendungen, sondern die Beschwerde, überhaupt zahlen zu müssen. Eine Diskussion, die ich auch im Freundes- und Familienkreis zunehmend führe.
Mal ganz abgesehen von der Frage, wie viele Menschen tatsächlich keinen Fernseher haben oder die Öffentlich-Rechtlichen nicht nutzen: Man möchte sich dieses Land ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht vorstellen. Und dafür muss man nicht auf Tagesschau, Korrespondenten-Netz oder Dokumentationen wie jene kürzlich gesendete über Amazon verweisen. Wie beispielsweise sähe es mit der Hörspiel-Produktion in diesem Land ohne die öffentlich-rechtlichen Kulturwellen aus? Wie mit dem Nachwuchs im Filmbereich, wenn die Dritten keine Debütfilme förderten? Und wie wäre es um die musikalische Landschaft bestellt, wenn Sender wie Fritz nicht immer wieder junge Bands spielen würden, noch bevor diese überhaupt einen Plattenvertrag besitzen?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Teil unserer Sozialisation: Als Kind habe ich die Sesamstraße und Rappelkiste geguckt, mit dreizehn bei Edgar Reitz‘ „Heimat“-Saga etwas über Zeitgeschichte und Gesellschaft gelernt, und als angehender Buchhändler war das „Literarische Quartett“ für mich Pflichtprogramm. Im besten Fall kann Fernsehen den Blick auf die Geschichte ändern – wie 1979 bei der vierteiligen amerikanischen Serie „Holocaust“ geschehen, einer „medien- und erinnerungsgeschichtlichen Zäsur“. Und was wäre die auf Twitter entbrannte Aufschrei-Debatte wert, wenn die Initiatorin am Sonntagabend nicht vor zehn Millionen Zuschauern bei Jauch sitzen würde? Man darf sich von der eigenen Mediennutzung nicht in die Irre führen lassen: Noch immer schauen die Deutschen 222 Minuten täglich fern; zwei Drittel der Zeit ihres täglichen Medienkonsums gehen trotz Internet für Radio und Fernsehen drauf.
WDR-Chefredakteur Jörg Schönenborn nennt den Rundfunkbeitrag denn auch eine „Demokratie-Abgabe“ und verweist darauf, dass es bei uns gesellschaftlicher Konsens sei, „dass wichtige Strukturen für das Zusammenleben gemeinschaftlich finanziert werden, und zwar egal, ob sie jeder persönlich nutzt oder nicht.“ Ich finanziere Autobahnen mit, obwohl ich selbst kein Auto besitze; ich zahle für Kitas, obwohl ich keine Kinder habe. Und ein Krankenhaus habe ich das letzte Mal vor vierzig Jahren von innen gesehen. Die Medienlandschaft steht all diesen Dingen in Wichtigkeit in nichts nach, wie nicht zuletzt ein Blick nach Russland oder Italien zeigt.
Gut möglich, dass ich mich ebenfalls aufregen würde, wenn ich Monat für Monat ausgewiesen bekäme, wie viel meines Gehalts ich in den Bau von Autobahnen investiere – insofern hat es der Rundfunkbeitrag vergleichsweise schwer. Da er aus gutem Grund keine Steuer sein darf (und ob das jetzige Modell eine ist, werden vermutlich die Gerichte klären), wird er sichtbar für jeden abgebucht. Dass daraus ein gewisser Legitimationsdruck entsteht, ist natürlich und sinnvoll. Die Beschwerde „Und dafür zahle ich GEZ!“ aber ist so hilfreich wie der Satz „Die da oben machen ja doch, was sie wollen“ in politischen Diskussionen.
... Link (21 Kommentare) ... Comment
Seit inzwischen zehn Jahren schreibe ich für die Wahrheit-Seite der taz – nicht des Geldes wegen, das ließe sich Klo putzend vermutlich schneller verdienen, sondern immer, wenn mir etwas am Herzen liegt. Wenn ein Thema mich überfällt und nicht mehr loslässt; wenn ich weiß, dass ich dazu etwas schreiben muss. Meist sind das ein oder zwei Artikel im Jahr – mir liegt nicht so viel am Herzen.
So war es auch bei meinem Text „Der ewige Israeli“, den ich Mitte Dezember schrieb – rund drei Wochen, bevor das Simon-Wiesenthal-Center mit seiner Liste der zehn ärgsten antisemitischen Ausfälle des vergangenen Jahres für Diskussionen sorgte. Ich ging am Strand von Ahrenshoop spazieren und dachte über einige vorgeblich israelkritische Texte nach, die ich in der vergangenen Zeit gelesen hatte, unter anderem von Jakob Augstein und Harald Martenstein. Mich nervten die Denk- und Sprachfiguren in diesen Texten, aber auch in der allgemeinen Nahost-Diskussion. In zehn Punkten versuchte ich, der Machart der Artikel auf die Schliche zu kommen. Denn so stereotyp wie der Inhalt war ihre Form.
Ich war mir nicht sicher, wie der Redakteur der taz meinen Artikel aufnehmen würde, denn bei diesem Thema weiß man nie so ganz, wie die anderen ticken. Es gibt Menschen, die ich mag und die intelligent sind, die in Sachen Israel recht merkwürdige Ansichten vertreten. Und es gibt Situationen, in denen ich die Auseinandersetzung vermeide, weil ich keine Lust auf eine Diskussion habe, die sowieso sinnlos ist. Denn das ist ja die Krux an der Sache: mit Intelligenz haben anti-jüdische Einstellungen und Ressentiments nichts zu tun.
Der Artikel sei sehr schön, antwortete der Redakteur, aber das werde Ärger geben. Oha, schrieb ich zurück. Was das heißen solle? Müsse ich mit Morddrohungen rechnen?
Nein, kleiner Scherz, versuchte der erfahrene Satiriker mich zu beruhigen. Meist sei es ja so, dass bei Themen, bei denen man Ärger erwarte, überhaupt nichts passiere.
Die Kommentare unter dem taz-Artikel lasen sich dann auch wie erwartet: Die Hälfte der Leser lobte den Text, die andere vertrat die Ansicht, ich wäre ein ahnungsloser Antideutscher mit Scheuklappen auf. Das beliebteste Gegenargument: Der Text würde Israelkritik tabuisieren – was ironischerweise Punkt 9 meiner zehn Schreibtipps war: „Behaupten Sie, man dürfe Israel nicht kritisieren, ohne als antisemitisch abgestempelt zu werden. Damit unterstreichen Sie zum einen Ihren eigenen Mut; zum anderen machen Sie Ihren Text unangreifbar, weil jegliche Kritik an ihm Ihre These bestätigt.“
Dieses behauptete Tabu ist natürlich keins. Erst kürzlich erschien eine wissenschaftliche Untersuchung, die besagt, dass über kein anderes Land so häufig und so kritisch berichtet werde wie über Israel. Und natürlich gibt es israelkritische Texte, die sich fundiert und argumentativ mit der Politik des Landes befassen, ohne antijüdische Ressentiments zu bedienen. Ohne es zu dämonisieren, deligitimieren oder doppelte Maßstäbe anzulegen – drei der wesentlichen Indikatoren, mit deren Hilfe zwischen legitimer Kritik an der Politik Israels und Antisemitismus unterschieden werden kann. Eine sachliche und scharfe Israelkritik ist also möglich und wird nicht zuletzt im Lande selbst gepflegt, wie der aktuelle Dokumentarfilm „Töte zuerst“ belegt. Wer sich bei seiner Kritik auf die zehn Punkte meiner satirischen Stilfibel angewiesen glaubt, dem ist nun wahrlich nicht mehr zu helfen.
Die Resonanz auf den kleinen Text jedenfalls war erstaunlich: Online war er der meistgelesene taz-Artikel der vergangenen drei Monate (übertroffen nur von einem Beitrag zum Thema Sex mit Tieren); er wurde auf Perlentaucher, Bildblog und leider auch dem rechtsextremen Blog „Politically Incorrect“ verlinkt. Er brachte das kleine Wunder zustande, sowohl von Henryk M. Broders „Achse des Guten“ als auch von Ken Jebsen zitiert zu werden. Wobei Jebsen eine sogenannte Gegendarstellung formulierte, die sich der Form meines Artikels bediente und mit den Worten „Jawohl, mein Führer!“ schloss – womit offensichtlich ich gemeint war.
Überhaupt diente die Form des Stil-Ratgebers als Blaupause für diverse andere Texte, zum Beispiel für das Blog Ruhrbarone, das seinerseits einen satirischen Schreibratgeber für islamfeindliche Texte verfasste. Vielleicht hätte ich mir die Form patentieren lassen sollen, dachte ich – oder ein Fernsehformat für Sonja Zietlow entwickeln: „Die zehn besten Schreibtipps für …“
Zum Beitrag der Ruhrbarone schrieb jemand auf Twitter, diese Islamfeindlichkeit gelte „leider genau für viele von Philip Meinhold‘s Fans“. Nun bin ich meinem Fanclub leider noch nie begegnet, aber falls es dazu kommt, kann ich ihm diesen Blog-Artikel gerne zeigen. Zwar fehlt mir ein wenig die Grundlage für diesen Text, denn außer in einer rechtsextremen Postille kann ich mir die meisten der aufgeführten Punkte kaum vorstellen. Aber natürlich: Vorurteile und Stereotype sind immer scheiße! Genau darum geht es doch.
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Last modified: 20.01.20, 13:07
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | ||||||
Wie könnte ich Sie per Email erreichen? Ich heiße Omer...
hab ich jahrzehntelang meinen schuldkomplex abgearbeitet war 1987 zwei wochen...
für den Artikel sehr gut. Dennoch bleibt zu behaupten, die...
ist ja auch, daß in den Townhouses die Wohnungen plötzlich senkrecht statt...
bereit ist, großzügige Räume im historischen Bestand (etwas Dachräume)...
Schrank der Großeltern ziehen? Dann sind die Sachen auch...
Frankfurt gibt es ja das neue "Europaviertel", von mir...
übriggeblieben man erkennt an dem posting allzudeutlich dass nicht...
den schuh an selten so gelacht tolle polemik lsd...
wenn man aufgehört hat, das Kino-ABC nach Hitchcocks zu...
Juni 2011 im Babylon Mitte mit Live-Orgelbegleitung. Großartig!
leider beleuchtet auch ihr hier verfasster Artikel die Problematik nicht wirklich....
aber diesen nicht. Siehe die Beiträge oben. Ich bin überhaupt...
persönliches Nutzungsprofil des ÖR ist ziemlich überschaubar: Von selber eigentlich...
Ich kann Abhilfe schaffen, um die Angst vor Tellerrändern (und...
Ich kann GEZ-Steuern mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ihr Beitrag...
Zur "Verbeamtung": Das ist ja ebenfalls eines der Vorurteile...
nicht über die sagenhafte Programmvielfalt eines Qualitätsmediums auf, sondern, über...
15-Jährigen, der bei seiner "Grafitti-Kunst" erwischt wurde und nun...
dann in der Gesellschaft, die zumindest die undifferenzierte Kritik...
ich GEZ!" ist also nicht hilfreich und reichlich abgedroschen? Gleiches...
wie sie mir gefällt.. aus pipi langstrumpf,eine serie die ich...