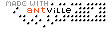Darf‘s ein Iced Flat White sein? Im großen Berliner Szenekiez-Roulette ist die Kugel jetzt bei Moabit liegen geblieben. Obwohl ich viele Jahre genau darauf gesetzt hab, will ich den Gewinn nicht mehr haben.
Vor gut zehn Jahren schrieb ich für ein großes Berliner Stadtmagazin einen Artikel über Moabit, in dem ich den Lesern das Viertel als einen lebenswerten Kiez andiente. Ich lobte den Tiergarten, den Plötzensee, die Lage, die Mieten – meine These: Moabit habe das Potenzial zum Szenebezirk. Damals wurde man noch angesehen, als käme man von einem anderen Stern, wenn man sagte, dass man hier wohne. Es gab keine Touristen, keine Clubs, keine Szenekneipen – und so gut wie nie kam einer meiner Freunde hierher, um sich mit mir zu treffen. Der Name des Viertels wurde allenfalls mit unschönen Wortverbindungen assoziiert: Justizvollzugsanstalt, Kriminalgericht, Krankenhaus. Hier gab es das Hauptquartier der Berliner Hells Angels, die Drogen- und Trinkerszene im Kleinen Tiergarten – und im Memory II (Sektfrühstück für 6,50 Mark) wurde sogar mal einer erschossen.
Bei Plus an der Stromstraße konnte sich nicht einmal die Wursttheke halten, weil das Geld der Anwohner gerade mal für die abgepackte Mettwurst reichte; und zwischen all den holzgetäfelten Eckpinten und einer handvoll gutbürgerlicher, aber sterbenslangweiliger Cafés gab es genau eine Kneipe, in der sich der angenehme Teil der Nachbarschaft traf. Wir passten an einen Tresen.
Doch trotz meines beschwörenden Artikels tat sich hier viele Jahre lang nichts, außer dass ein Internetcafé öffnete, während ein anderes schloss, und die Stromstraße versuchte, in Sachen Spielcasinodichte Las Vegas den Rang abzulaufen.
Als dann tatsächlich die ersten Vorboten der Veränderung kamen, nahmen wir Alteingesessenen diese halb belustigt, halb erstaunt zur Kenntnis: Am S-Bahnhof Westhafen eröffnete ein Hostel (Haha!); in der sanierten Markthalle gab es statt Currywurst und Engelhardt jetzt Bio-Burger und selbstgebrautes Bier (Warum nicht?); und auf der Brache der ehemaligen Paechbrot-Fabrik machte sich ein Einkaufszentrum namens Moa-Bogen breit, mit Fitnessstudio, Berlins größtem Asia-Buffet und Hotel – sowie einem Supermarkt mit riesiger Frischtheke für Wurst, Käse und Fisch (also doch!).
Seit ein paar Monaten geht es nun Schlag auf Schlag: Eine Coffee Bar verkauft Iced Chai, Blended Espresso und – whatever that means – Iced Flat White; direkt daneben eröffnet demnächst ein Second Hand Store für Edeltrash. Auf Stromkästen werben Plakate für eine Elektro-Party namens „Klangtherapie Moabit“ (mit DJ vom Tresor und dem Suicice Circus), sogar Barhopping kann man betreiben: Es gibt eine Tapas-, eine Nobel- und zwei Hipsterbars, letztere mit den üblichen unverputzten Wänden, zusammengeklaubten Wohnzimmermöbeln und einem Getränkeangebot von Mate Jäger bis Aperol Spritz. Dort, wo sich einst eine der ranzigsten Imbissbuden West-Berlins befand, kann man sich jetzt statt „Pommes rot-weiß“ ein Frühstücksangebot in den Geschmacksrichtungen herzhaft, vegetarisch und vegan bestellen. Was ist nur mit der guten, alten Asozialität geschehen? Man hört das Geräusch von Rollkoffern auf Kopfsteinpflaster, Englisch, Französisch – das dümmste Gewäsch verstehe ich zum Glück nur auf deutsch („Sie wollte ihn pushen, damit er sich als Künstler etablieren kann. Er ist immer so negativ.“)
Vor zehn Jahren hätte ich mich über jede einzelne dieser neuen Lokalitäten und Läden gefreut – und ein wenig tue ich das zugegebenermaßen noch immer: ein Kulturzentrum! Eine Bar! Ein Café! Doch die Zeit der ungetrübten Freude ist, was diese Dinge angeht, seit ein paar Jahren vorbei. Wir wissen, was das bedeutet: die Mieten! Die Monokultur! Dieser Hype! Wahrscheinlich ist es hier die nächsten zwei, drei Jahre ganz nett, fünf weitere bezahl- und aushaltbar. Danach kommen die Junggesellenabschiede, die Bierbikes, und einem wird in den Hausflur gereiert. Mieter ohne Altverträge und erkleckliches Einkommen können nach Reinickendorf, Marzahn und in die Uckermark ziehen.
Mein Artikel für das Stadtmagazin vor zehn Jahren endete übrigens mit dem Satz: „Wahrscheinlich, ist es das, was mir hier am besten gefällt: dass Moabit Szenebezirk werden könnte. Aber es wohl niemals wird.“ Mein Gott, ich war jung und naiv.
... Link (3 Kommentare) ... Comment
Wenn von der vielzitierten Gentrifizierung die Rede ist, dann geht es meist um explosionsartig steigende Mieten, die Verdrängung kultureller Einrichtungen aus einem Kiez, den mit der Aufwertung verbundenen Austausch ganzer Nachbarschaften. So gut wie nie geht es dabei um ästhetische Fragen, obwohl diese doch eigentlich am offensichtlichsten sind – sprich: um die architektonische Verschandelung unserer Stadt.
Immer wieder passiert es mir in letzter Zeit, dass ich in eine Gegend komme, in der ich eine Weile nicht war, und mit Schrecken feststelle, dass ein weiterer Häuserblock oder Straßenzug mit jenen loftartigen Luxuswohnungen verbaut ist, die angeblich für stilvolles Wohnen stehen. Überall die gleichen sterilen Fassaden aus Glas und Stahl, riesigen Balkone und Fensterfronten – ein glatt gebügelter Einheitslook, so als würde „Germany‘s Next Top Model“ neuerdings Häuser casten. Wie Hunde, die ihre Gegend markieren, hinterlassen Investoren, Projektentwickler und Architekten diese Immobilien des Grauens an jeder Ecke der Stadt.
Mit der Loftwohnung, wie wir sie aus den Siebziger- und Achtzigerjahren kennen, hat ihr neureicher Namensvetter dabei so gut wie nichts mehr gemein – im Gegenteil: Waren Lofts damals improvisierte Wohnungen in ehemaligen Gewerbegebäuden, in denen vornehmlich Künstler Wohnen und Arbeit miteinander verbanden, so handelt es sich heute um aufwändig modernisierte alte Fabrikhallen mit Fußbodenheizung, Luxusbad und repräsentativem Kamin oder um gänzlich neu errichtete Bauten. Ein Ego-Back-Up für Menschen, denen ihr SUV nicht genügt.
Dabei muss man nicht mal die absurdesten Auswüchse wie das Kreuzberger Carloft bemühen, bei dem man seinen Mercedes mittels Fahrstuhl mit in die Wohnung nehmen kann, um festzustellen, dass Geld und Stil nicht zwangsläufig im gleichen Haus wohnen. Drinnen geht es meist so pseudo-dekadent weiter wie draußen: Zimmer im klassischen Sinne gibt es nicht (so als könnte man sich nach der Dusche mit Rainshower und den elektrischen Markisen keine Wände mehr leisten); bis auf ein winziges Schlafzimmer und das Bad ist die Wohnung vollkommen offen. Was auch zeigt, für wen diese garantiert nicht gedacht ist: für Familien, Freunde oder WGs – stattdessen für besserverdienende Paare, die sowieso kaum zu Hause sind, weil der ganze Klimbim ja finanziert werden muss, sowie für gutbetuchte Auswärtige, die das Ganze eher als Wertanlage anstatt als Wohnraum verstehen.
Städtebaulich flankiert wird die Flachdacharchitektur von der biederen kleinen Schwester des Luxuslofts namens „Townhouse“, das die Kleinbürgerlichkeit eines Reihenhauses mit dem Auftritt des Snobs verbindet – eine unangenehme Kombination. Wobei das Störende nicht das einzelne Loft oder Townhouse ist, sondern die stadtweite Uniformität dieses – im Investorensprech – vorgeblich „individuellen Wohnens“. Dazu die Bürobauten, Bettenburgen, Einkaufscenter – es ist die „Zeit der trostlosen Investoren-Architektur“, wie Spiegel-Redakteur Georg Diez es nennt, „ein Nichts von spätkapitalistischer Tristesse“.
Es war der Filmemacher Alexander Kluge, der darauf verwies, dass nicht nur Menschen Lebensläufe besitzen, sondern auch Gegenstände und Gebiete. Die Biographie Berlins beispielsweise besteht – wenn man die Schaffung einer einheitlichen Stadtgemeinde als Ausgangspunkt nimmt – aus etwa zwölf Generationen. Doch statt die Vergangenheit in der gewachsenen städtischen Architektur präsent zu halten, verwandeln wir Kieze mit Charme und eigenem Charakter Straße für Straße, Haus für Haus, in gesichts- und geschichtslose Gegenden, die austauschbar sind. Geradezu zynisch liest sich da das wandhohe Zitat Karl Foersters im Eingangsbereich einer Luxusresidenz an der Schönhauser Allee: „Seltsam wie das Leben rauscht und auch am alten Orte immer wieder völlig neu ist.“
Und so brauchen wir neben Milieuschutz, Mietpreisbremse und Zweckentfremdungsgesetz vor allem das öffentliche Bewusstsein, dass die Vielfalt zum Charakter dieser Stadt gehört. Und dieser spiegelt sich nicht zuletzt in ihrer Architektur.
... Link (4 Kommentare) ... Comment
Der folgende Text stammt aus dem Jahr 2009 und ist in meinem E-Book „O Jugend, o West-Berlin“ enthalten.
Touristen und frisch Hinzugezogenen mag Berlin wahlweise groß, laut, schnell, grün, lebendig, verrückt oder schroff vorkommen – uns Berlinern fällt das nicht weiter auf. Und auch, wie die Stadt sich verändert hat, nehmen wir im Alltag nicht wahr, so wie man die Veränderung eines Freundes, Bruders oder der Mutter nicht wahrnimmt, die man regelmäßig sieht, mit denen zusammen man altert und die für einen aussehen wie immer. Und was anderes als Freund, Bruder oder Mutter ist Berlin denn für uns?
Natürlich wissen wir, dass die Stadt sich verändert hat, aber wie nun genau, das hat die Gewöhnung verwischt. Wie hat sie ausgesehen, gerochen, sich angefühlt – vor zwanzig Jahren, als die Mauer noch stand? Vor fünfzehn Jahren, als die Stadt gebaut wurde, in der wir jetzt leben? Vor zehn Jahren, als die Bonner und Beamten kamen und in ihrem Gefolge die Medien, Konzerne, Kulturschaffenden? Berlin ist wie ein Gemälde, das die ersten Pinselstriche enthält, sie gleichzeitig aber nicht preisgibt.
Es ist eine Fahrt mit dem Motorroller, die für mich zu einer Zeitreise wird. Vielleicht, weil ich die Strecke so häufig gefahren bin, dass die Routine mir den Blick für die Vergangenheit öffnet; vielleicht liegt es auch an der Strecke an sich: von Moabit nach Kreuzberg, ein Mal diagonal durch die Mitte, entlang der nagelneuen Naht aus Beton, Stahl und Glas, unter der die ehemalige Grenze vernarbt. Zwanzig Jahre Berlin in zwanzig Minuten, eine Motorradfahrt entlang der Veränderung.
Ich lasse die Untersuchungshaftanstalt Moabit hinter mir, die mit der Liste ihrer Insassen auch eine Geschichte dieser Stadt erzählt: von Rosa Luxemburg über Bommi Baumann bis zu Erich Mielke. Auf dem Mittelstreifen vor der Mauer malt eine junge Frau ein Herz in die Luft – in der obersten Etage des Gebäudes hinter der Mauer schaut ein Mann durch die vergitterten Fenster.
Ich fahre am Edelrestaurant „Paris – Moskau“ vorbei, an dessen Fassade ein Transparent das 25-jährige Jubiläum verkündet – das ist wohl das, was man einen richtigen Riecher nennen muss: Fünf Jahre vor dem Mauerfall an diesem entlegenen Winkel der Welt ein Nobelrestaurant zu eröffnen, das nun in Fußweite von Parlaments- und Regierungssitz liegt.
Links winkt der Hauptbahnhof, der aussieht wie ein gelandetes Ufo, rechts das Kanzleramt mit seinen kubischen, runden, verschachtelten Formen, die irgendwas von Innen und Außen und Transparenz erzählen sollen – also wenig von politischer Realität. Wie eine Disney-Landschaft kommen mir diese modernen, ins Nichts geklotzten Bauwerke vor, wie ein Themenpark „Futurismus“. Und wer weiß, in ein paar tausend Jahren werden Touristen vielleicht die Rudimente des Regierungsviertels besichtigen wie die Athener Akropolis oder das Forum Romanum in Rom.
Die Straße schlängelt sich an Schweizerischer Botschaft, Paul-Löbe-Haus und Reichstag vorbei, der zu Mauerzeiten nicht mehr war als ein funktionsloses Gebäude aus dem Geschichtsbuch: Auf der Wiese davor haben wir Fußball gespielt, ansonsten diente das Gebäude als Kulisse für skurrile Konzerte – die Pudhys, Nina Hagen und Michael Jackson haben hier gespielt. Drinnen trafen sich die Bundestagsfraktionen auf Berlin-Trip zu symbolischen Sitzungen, eine Dauerausstellung stellte „Fragen an die Deutsche Geschichte“, die ein paar Meter hinter dem Gebäude ihre Antwort fanden.
Ich biege auf die Straße des 17. Juni ein – wie Horst Buchholz in „Eins, zwei, drei“ komme ich mir hier immer vor, wenn er mit seinem Motorrad auf das Brandenburger Tor zufährt. Kurz hinter der Stelle, wo er den Warnhinweis „You are leaving the american sector“ passiert, biege ich ab und fahre an der Amerikanischen Botschaft vorbei. Wie in einem Freilichtmuseum reihen sich Brandenburger Tor, US-Botschaft und Holocaust-Mahnmal aneinander, so als stünden hier die Determinanten der jüngeren deutschen Geschichte Spalier.
Weiter vorne streckt der Potsdamer Platz seine Arme aus, und wenn es stimmt, dass Berlin „arm, aber sexy“ ist, wie unser Bonmot-Bürgermeister behauptet, dann ist es hier protzig und unattraktiv. Einer dieser gesichts- und geschichtslosen Orte des neuen Berlin, die auch in Paris oder Rom liegen könnten – eben so, wie sich Architekten und Investoren aus der Provinz eine Weltstadt vorstellen.
Ein paar Scientologen werben um Opfer, Rikschafahrer warten auf Kunden, Touristen bestaunen ein paar Segmente der historischen Mauer, die sich unter den in den Himmel wachsenden Häusern geradezu lächerlich ausnehmen. Und davon hat irgendwer sich abhalten lassen?
Ich frage mich, wo unser Zelt gestanden hat, damals, im Sommer 88. Als Westberliner Umweltschützer ein Stück Brachland besetzten, das auf der Westseite der Mauer lag, aber zum Osten gehörte. Mit einem Dorf aus Hütten und Zelten protestierten wir gegen den Bau einer Autobahn, der drohte, wenn die Brache in das Eigentum West-Berlins überging. Stand unser Zelt unter dem Bahn-Tower? Dem Sony Center? Den Potsdamer Platz Arkaden? Und wo hat das zum Techno-Club umfunktionierte unterirdische Pissoir sich befunden, in dem wir vier Jahre später Silvester gefeiert haben – als diese steingewordene Weltstadtphantasie noch eine Wüste war? Als die Clubs noch Adressen statt Namen hatten oder wie ihre ehemalige Bestimmung hießen: Obst und Gemüse, E-Werk, Friseur? Es ist nicht mehr nachzuvollziehen. Ein paar Jahre später dirigierte Daniel Barenboim hier sein Ballett der Kräne, und verkaufte cleveres Stadtmarketing Baustellen als Sehenswürdigkeiten. Heute sind die Baulücken geschlossen und die Brachen bebaut, der Wildwuchs weitestgehend gezähmt. In den 90ern fand die Nachkriegszeit in Berlin auch ihr städtebauliches Ende.
Ich biege in die Niederkirchnerstraße ein und fahre ein Stück an der Mauer entlang, deren Verlauf mich hier immer etwas irritiert, weil ich vom Westen durch den Osten in den Westen fahre. Auf der ehemaligen Westseite: der Martin-Gropius-Bau; im ehemaligen Osten: der Preußische Landtag. Ich muss an Wowereit, Momper und Diepgen denken, an 25 Jahre Berliner Bürgermeister – merkwürdig, dass die Westberliner Provinzialität ausgerechnet hier überlebt hat. Als hielten sich die Berliner an ihren Politikern fest wie an einem Rettungsring in stürmischen Zeiten.
Weiter geht es in die Kochstraße, am weltberühmten Checkpoint Charlie vorbei, der uns zu Mauerzeiten so wenig interessiert hat wie die Mauer selbst. Nie sind wir auf eine der Aussichtsplattformen gestiegen, um nach drüben zu schauen. Die Mauer war für uns nicht mehr als das Ende einer Sackgasse, in die man geriet – nur dass in allen Richtungen Sackgassen waren, was Berlin zu einer riesigen verkehrsberuhigten Spielstraße machte.
Vorbei geht’s an der taz und – nur einen Steinwurf entfernt – dem Axel-Springer-Hochhaus. Dass das jetzt in der Rudi-Dutschke-Straße liegt, ist natürlich ganz witzig (und offenbart den Sinn der Berliner für einen recht trockenen Humor), aber vielleicht auch nur ein Beleg für den Weg der Alt-Achtundsechziger in den Mainstream. Klar, dass Bild-Chef Kai Diekmann im Gegenzug auch Genossenschaftler der taz werden darf.
Es ist schon merkwürdig: Wenn man das Berlin von heute mit dem Blick von damals ansieht, so als wäre man nicht mit der Vespa, sondern mit einer Zeitmaschine unterwegs, dann wirkt es wie eine Zukunftsvision aus einem Seyfried-Cartoon: der Springer-Verlag sitzt in der Rudi-Dutschke-Straße, auf dem einst besetzten Lenné-Dreieck ragen Hochhäuser von Daimler, Sony und Deutscher Bahn in den Himmel, vor dem Reichstag gibt es eine U-Bahn-Station namens Bundestag.
Höchste Zeit, dass es ins gute alte Kreuzberg geht, wo die Nächte lang sind, die Geschäfte türkisch und die Grünen die stärkste Partei – das inzwischen aber auch nicht mehr so gut und alt ist wie früher. Lange hat sich Kreuzberg weggeduckt unter dem Wandel der Stadt, so als könnte man es übersehen. Doch in den vergangenen paar Jahren ist die Veränderung auch hier angekommen: Die Schlesische Straße, diese ausgestorbene Sackgasse am Ende West-Berlins, hat sich zu einer Partymeile mit Clubs, Cafés und Kneipen gewandelt. Es gibt Boutiquen und Bars, die man eher im schicken Mitte vermuten würde und die sich wie das „Molotow“ in der Oranienstraße nur mit ihrem Namen an das alte Kreuzberg ranschmeißen. An den Wochenenden verwandeln einheimisches Szenevolk und ausländische Partytouristen den Kiez mit der ehemaligen Postleitzahl 36 in einen riesigen Vergnügungsbezirk. Auf den Straßen hört man Amerikanisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch – und was die Spanier angeht, so kann man das Gefühl bekommen, dass Kreuzberg ihre Rache für Mallorca ist.
Mit den Szenebezirken verhält es sich in Berlin wie mit dem Raubbau: Wenn eine Gegend erschlossen und ausgenommen ist, zieht die Karawane weiter, bis auch der nächste Kiez mit Cafés, Clubs, Kneipen und Hostels planiert ist, und statt Szenevolk nur noch Prolls und Touristen kommen. Nach der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain und der Oranienburger in Mitte sind nun also die Wiener Straße und die O-Straße dran. Die Ausläufer ziehen sich über den Landwehrkanal bis nach Neukölln hinunter. Man muss nicht auf das Vorzeigeprojekt MediaSpree, die 02 World oder die erste Kreuzberger MacDonalds-Filiale schauen, um zu merken, das sich hier etwas tut. Im Grunde verhält es sich mit Kreuzberg wie mit Berlin: Die Stadt ist schneller, glatter, teurer, professioneller geworden – ähnlich einer Rockband, die es vom Insider-Tipp auf die Bühnen der großen Stadien geschafft hat und deren Image nun weltweit vermarktet wird. Berlin, so schreibt Tobias Rapp in seinem Buch „Lost and Sound“, sei die „Feier-Hauptstadt der westlichen Welt“.
Ich schwinge mich auf meinen Roller und fahre zurück – über Kochstraße, Potsdamer Platz, Straße des 17. Juni –, bis nach Moabit, wo die Namen der Kneipen auf -Eck oder -Stuben enden; wo es Schultheiß und Engelhardt gibt statt Tannenzäpfle und Becks; wo die größte Veränderung ist, dass ab und zu ein neues Telecafé eröffnet, während ein anderes schließt. Ob der Berlin-Boom irgendwann auch hier ankommen wird?
Manchmal habe ich Angst um Berlin, davor, dass diese Stadt nicht mehr meine ist. Doch dann denke ich: Diese Stadt hat so viel mitgemacht in den vergangenen Jahrzehnten – war Ausgangspunkt von Krieg und Empfänger der Quittung, hat Blockade, Teilung und Vereinigung erlebt –, sie wird auch diesen Hauptstadthype überstehen. Sollen sie uns ruhig weitere 10.000 Beamte und Provinzler schicken und von mir aus noch 100.000 spanische Touristen dazu, sollen sie die Baulücken schließen und die Brachen bebauen: Unkraut, denke ich, vergeht nicht – und das ist ein schöner Gedanke. Das Regierungsviertel im Rücken fahre ich vor der Justizvollzugsanstalt rechts, dann bin ich wieder zu Hause.
(2009)
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Last modified: 20.01.20, 13:07
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Juni | ||||||
Wie könnte ich Sie per Email erreichen? Ich heiße Omer...
hab ich jahrzehntelang meinen schuldkomplex abgearbeitet war 1987 zwei wochen...
für den Artikel sehr gut. Dennoch bleibt zu behaupten, die...
ist ja auch, daß in den Townhouses die Wohnungen plötzlich senkrecht statt...
bereit ist, großzügige Räume im historischen Bestand (etwas Dachräume)...
Schrank der Großeltern ziehen? Dann sind die Sachen auch...
Frankfurt gibt es ja das neue "Europaviertel", von mir...
übriggeblieben man erkennt an dem posting allzudeutlich dass nicht...
den schuh an selten so gelacht tolle polemik lsd...
wenn man aufgehört hat, das Kino-ABC nach Hitchcocks zu...
Juni 2011 im Babylon Mitte mit Live-Orgelbegleitung. Großartig!
leider beleuchtet auch ihr hier verfasster Artikel die Problematik nicht wirklich....
aber diesen nicht. Siehe die Beiträge oben. Ich bin überhaupt...
persönliches Nutzungsprofil des ÖR ist ziemlich überschaubar: Von selber eigentlich...
Ich kann Abhilfe schaffen, um die Angst vor Tellerrändern (und...
Ich kann GEZ-Steuern mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ihr Beitrag...
Zur "Verbeamtung": Das ist ja ebenfalls eines der Vorurteile...
nicht über die sagenhafte Programmvielfalt eines Qualitätsmediums auf, sondern, über...
15-Jährigen, der bei seiner "Grafitti-Kunst" erwischt wurde und nun...
dann in der Gesellschaft, die zumindest die undifferenzierte Kritik...
ich GEZ!" ist also nicht hilfreich und reichlich abgedroschen? Gleiches...
wie sie mir gefällt.. aus pipi langstrumpf,eine serie die ich...