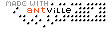Mit meinem E-Book „O Jugend, o West-Berlin“ habe ich beim Indie-Autor-Preis 2015 den 2. Platz belegt. Leider stand der Laudator während der Preisverleihung auf der Leipziger Buchmesse im Stau. Die Laudatio von Marco Verhülsdonk, Leiter E-Book und Online beim KiWi-Verlag, gibt's daher jetzt exklusiv hier.
Mitten im 2012er Reunion-Konzert von Plan B, einer Berliner Rockband die immerhin mal Vorgruppe der Ramones war, sieht sich ein glücklich tanzender und mitsingender 40jähriger im Publikum unter Seinesgleichen um und stellt fest: “Wahrscheinlich sind hier zu 90 Prozent Westberliner. Und, nein an dieser Stelle nichts gegen Zugezogene oder Touristen – aber für einen Moment möchte man trotzdem ganz still werden und atmen und denken: So war’s! Wir wissen was wir hier teilen (…) das ist meine 80er Jahre Party, und klar bin ich ein sentimentaler Hund, aber ich würde sogar meine Riester Rente vesetzen, wenn ich dafür noch mal ein paar Tage ins alte Westberlin reisen könnte“ – gemeint ist jenes unfertige unvollkommene geteilte Berlin, das ihm im Nachhinein „wie ein Auslaufplatz für Fantasien und Illusionen“ vorkommt. Und weiter: „Die Vergangenheit ist nichts, was einfach so endet. Denn was, wenn nicht die Summe unserer Erinnerungen, macht uns aus? Was macht uns zu denen, die wir sind?“
Der, der an diesem Reunion-Abend im Zeichen einer untergegangen Zeit in einer untergegangenen Stadt so fragt und empfindet ist Philip Meinhold. Freier Journalist, Schriftsteller und der Autor des eBooks „O Jugend, O West-Berlin“, das ich hier im Namen der Jury des Indie Autor Preises loben möchte. Dies fällt mir leicht, nicht nur weil auch ich Plan B als Vorgruppe der Ramones gesehen habe, sondern weil Philip Meinhold mit „O Jugend, O West-Berlin“ ein sehr gut geschriebenes, unsentimentales, doppeltes Erinnerungsbuch gelungen ist.
Doppelt gemäß einer Aussage von Alexander Kluge, nach der nicht nur Menschen sondern auch Gegenstände und Landschaften Lebensläufe haben. Denn in dieser Textsammlung spiegeln sich vier Jahrzehnte persönliche Geschichte und die Entwicklung Berlins: Der Autor, ausgestattet mit einem dezidiert Westberliner Lebensgefühl, wird nach und nach zum Zeitzeugen einer Stadt, die sich Stück für Stück ändert, von der provinziellen, leicht miefig und verkehrsberuhigt anmutenden Großstadtinsel der 70er und 80er Jahre über die Metropole nach dem Mauerfall bis zur heutigen Partyhauptstadt der westlichen Welt. Und so verknüpft sich in diesem Buch die Biographie des Autors mit der seiner Stadt.
Ganz chronologisch erinnert sich Philip Meinhold zunächst an eine Kindheit und Jugend in den 70/ 80er Jahren, an die Lektüre des Quelle-Katalogs und an die des "Fänger im Roggen". Vor allem an West-Berlin: An Eberhard Diepgen und die Deutschlandhalle, an seine Musiksozialisation bei der „Hey Musik“ Radioshow aus dem Haus des Rundfunks, an das Turmstraßenfest und den Karneval der Kulturen, an die für alle Berliner obligatorischen Besuche auf der Grünen Woche und an jene in der sozialistischen Sesamstraße namens Grips Theater, an die Junge Union, an die für Westberliner Fußballvereine typische Mischung aus Größenwahn und Missmanagement, an das Gegen- und Nebeneinander der Jugendkulturen sowie an das für den Pubertierenden nicht minder verwirrende Big Sexyland.
Der Autor schaut jedoch nicht nur in die Vergangenheit, er richtet den Blick auf den fortwährenden Wandel einer Stadt, deren Differenz zwischen Damals und Heute Merkwürdigkeiten produziert: „Wenn man das Berlin von heute mit dem Blick von damals ansieht, dann wirkt es wie eine Zukunftsvision aus einem Seyfried-Cartoon: der Springer Verlag sitzt in der Rudi Dutschke Straße, auf dem einst besetzten Lenné-Dreieck ragen Hochhäuser von Daimler, Sony und Deutscher Bahn in den Himmel und vor dem Reichstag gibt es eine U-Bahn-Station namens Bundestag“. Mit dem an der Vergangenheit geschulten Blick bewegt Meinhold sich entlang des Berliner Sozialäquators, bereist Ostberlin mit einem alten Baedeker Reiseführer, hält eine launiges Plädoyer für das ewig unhippe Moabit, besichtigt die Hölle der neuen Szeneviertel Neukölln und Kreuzberg („die Rache der Spanier für Mallorca“), nur, um sich abschließend – ganz Berliner, der er ist - selbst zu beruhigen: "Diese Stadt hat so viel mitgemacht in den vergangenen Jahrzehnten, war Ausgangspunkt von Krieg und Empfänger der Quittung, hat Blockade, Teilung und Vereinigung erlebt, sie wird auch diesen Hauptstadthype überstehen. [...] Unkraut, denke ich, vergeht nicht, und das ist ein schöner Gedanke."
Insgesamt sind die Texte wie Erinnerungen nun mal sind: bruchstückhaft, sprunghaft und subjektiv. Mal nostalgisch und wehmütig (wie der Titel es verheißt), dann wieder polemisch und wütend, bisweilen mit einem Hauch Selbstironie und nie ohne Witz.
Die Entscheidung, dieses Sachbuch auszuzeichnen, fiel also aufgrund der Qualität der Texte, die sich zu einem kaleidoskopischen Berlin-Erinnerungsbuch fügen. Und, gestatten Sie mir diese Anmerkungen, vielleicht hat die handwerkliche Qualität dieser essayistischen Betrachtungen, Reportagen, Glossen und Kolumnen außer mit dem Können des Autors auch damit zu tun, dass die meisten der hier versammelten Texte bereits in verschiedenen Zeitungen erschienen sind, in der taz, Jungle World, brand eins und Frankfurter Rundschau --- und also professionell redigiert und in einem Lektorat veredelt wurden. Schließlich überzeugt auch die klare Marketingausrichtung: eine Anzeigen-Kooperation mit dem Berliner Stadtmagazin Zitty: Das E-Book (2.99€) enthält eine Zitty-Anzeige, dafür erschienen in vier Ausgaben der zielgruppenaffinen Zitty Anzeigen für das Buch. Und neben eigener PR über das Autoren Facebook-Profil, auf Twitter sowie seinem Blog gab der Autor auch Radio-Interviews zum Buch bei Flux.FM und 88.44 und Lesungen in Kreuzberg.
Bleibt mir nur mit den Ramones zu sagen: Hey ho, let’s go!
Und: Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Meinhold, zu diesem kurzweiligen und erhellenden biografischen Berlin Bummel und zum 2. Platz des Indie Autor Preises 2015!
(Marco Verhülsdonk)
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Der folgende Text stammt aus dem E-Book „O Jugend, o West-Berlin“.
„Berliner Entscheidungsfindung!“ Uli aus München schüttelte genervt den Kopf. Eine halbe Stunde schon standen wir klappernd vor Kälte an der Straßenecke und beratschlagten, wo wir jetzt hingehen sollten. Ins Café M? Da fanden wir sowieso keinen Platz. Ins Behrio? Ganz nett, aber zu wenig Frauen – und wir wollten uns wenigstens die Illusion bewahren, die Frau unseres Lebens zu treffen. In die Mutter? Kein vernünftiges Fassbier, nur das Scheiß-Scherdel, und dann auch noch viel zu teuer.
Für uns war es das samstägliche Eckensteh-Ritual, für meinen Münchener Besuch eine typische Berliner Eigenheit: die Unfähigkeit, sich kurz und knackig auf ein Café zu einigen. Dabei hatte es durchaus Zeiten gegeben, als das noch ging. Und dass es nun anders gekommen war, daran war einzig und allein die Rockerbraut Schuld.
Etwa zehn Jahre war es jetzt her, dass wir das Café Lux entdeckt hatten. Luxi, wie wir es schon bald liebevoll nannten. Für uns, frisch-examinierte Abiturienten, war das Lux eine Gottesgabe: cool genug, um sich dort sehen zu lassen, aber nicht so cool, dass wir uns darin uncool vorkamen. Die Wände bestanden aus rohen Ziegeln, im Zigarettenautomaten gab es P&S statt HB. Durch die Glasfront konnte man auf die Goltzstraße sehen, den Laufsteg der Schöneberger Szene. Wir saßen auf der roten Lederbank an der Wand, tranken Becks aus der Flasche, rauchten P&S, und wenn der Käsestangen-Verkäufer seine am Korb befestigte Klingel betätigte, rissen wir jubelnd die Arme hoch und schrien „Jawoll!“ und „Hurra!“.
Das Lux wurde Ausgangs- und Endpunkt unserer Abende – wobei wir es zwischen den beiden Punkten meistens gar nicht verließen. Für einen Ortswechsel hatten wir zu viel zu besprechen. Wir diskutierten, welches das beste Dijan-Buch sei und ob ein Comeback der Clash wünschenswert wäre. Wir stritten über die Vorzüge der verschiedenen Elemente des Haribo-Mixes – Frösche, Lakritzstangen und Spiegeleier –, und darüber, ob man es in zehn Jahren schaffen könne, Claudia Schiffer zu poppen. „Nie im Leben“, sagte Boris, „wie willst du denn rankommen an die?“ Rühle war anderer Meinung: „Wenn man alles andere diesem Ziel unterordnet, kannst du‘s schaffen! Du kannst eine Biographie über sie schreiben und sie so kennenlernen oder dich mit ihrem Gärtner befreunden. Wenn du es wirklich willst, kriegst du jede.“ – „Ach, und warum bist du dann seit zwei Jahren Single?“ – „Weil ich lieber mit euch im Luxi abhänge, du Spast.“ Nirgendwo konnte man Nichtiges so wichtig besprechen wie hier.
Wahrscheinlich würden wir noch heute so sitzen, das neueste Dijan rezensieren, darauf warten, dass The Clash reüssieren – wenn nicht eines Tages die Rockerbraut aufgetaucht wäre. Die Rockerbraut war die neue Bedienung. Sie trug Sekretärinnen-Brille und Rockröhren-Outfit, Cowboystiefel und kneifenge Jeans. Doch wäre ihr Äußeres noch zu ertragen gewesen, so war es ihr Musikgeschmack nicht: Als gälte es, einen Tanztee für alternde Hells Angels auszurichten, beschallte sie uns mit Aerosmith, Bryan Adams und Kiss. Anfangs versuchten wir noch, es mit Humor zu nehmen. Wir malträtierten unsere Luftgitarren und riefen: „Wir haben ja nichts gegen eine gepflegte Beatmusik.“ Unser einschränkendes „Aber“ wurde bereits vom nächsten Gitarrensolo verschluckt. Bald aber begannen wir durch die Fensterfront zu lugen, bevor wir das Luxi betraten. Wenn die Rockerbraut Tresendienst hatte, sagten wir: „Der DJ stimmt nicht“, und schlichen bedröppelt von dannen. Wer wollte von den Clash reden, wenn die Scorpions heulten? Wer Claudia Schiffer erwähnen, wenn Tina Turner rockte?
Wir mussten uns immer öfter schleichen. Die Rockerbraut hatte fast täglich Dienst, und irgendwann hieß es, sie habe das Lux übernommen. Im Hinterzimmer stellte sie einen Billiardtisch auf; bei der Metamorphose zum Musikcafé fehlten nur noch der Sand auf dem Boden und die Plastikpalmen. Wir gingen an unserer alten Liebe wie an einer verflossenen vorbei: Man weiß, dass es schön war, aber man versteht es nicht mehr; man kann nicht mehr nachvollziehen, was man einst an ihr fand.
Und als ich kürzlich das Luxi passierte, da war es gar nicht mehr da: Ein Yuppie-Café namens „Trüffel“ residiert nun in den Räumen; die Rockerbraut hatte das Lux zu Grunde beschallt. Zwar konnte ich mir ein grimmiges Lächeln nicht verkneifen, doch dieses Lächeln gefror mir schon bald im Gesicht. Am nächsten Wochenende standen wir klappernd vor Kälte mit Uli an der Ecke und überlegten, ob wir ins M, das Behrio oder die Mutter gehen sollten. Man hatte uns die Heimat genommen.
(2001)
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Der folgende Text stammt aus dem Jahr 2009 und ist in meinem E-Book „O Jugend, o West-Berlin“ enthalten.
Touristen und frisch Hinzugezogenen mag Berlin wahlweise groß, laut, schnell, grün, lebendig, verrückt oder schroff vorkommen – uns Berlinern fällt das nicht weiter auf. Und auch, wie die Stadt sich verändert hat, nehmen wir im Alltag nicht wahr, so wie man die Veränderung eines Freundes, Bruders oder der Mutter nicht wahrnimmt, die man regelmäßig sieht, mit denen zusammen man altert und die für einen aussehen wie immer. Und was anderes als Freund, Bruder oder Mutter ist Berlin denn für uns?
Natürlich wissen wir, dass die Stadt sich verändert hat, aber wie nun genau, das hat die Gewöhnung verwischt. Wie hat sie ausgesehen, gerochen, sich angefühlt – vor zwanzig Jahren, als die Mauer noch stand? Vor fünfzehn Jahren, als die Stadt gebaut wurde, in der wir jetzt leben? Vor zehn Jahren, als die Bonner und Beamten kamen und in ihrem Gefolge die Medien, Konzerne, Kulturschaffenden? Berlin ist wie ein Gemälde, das die ersten Pinselstriche enthält, sie gleichzeitig aber nicht preisgibt.
Es ist eine Fahrt mit dem Motorroller, die für mich zu einer Zeitreise wird. Vielleicht, weil ich die Strecke so häufig gefahren bin, dass die Routine mir den Blick für die Vergangenheit öffnet; vielleicht liegt es auch an der Strecke an sich: von Moabit nach Kreuzberg, ein Mal diagonal durch die Mitte, entlang der nagelneuen Naht aus Beton, Stahl und Glas, unter der die ehemalige Grenze vernarbt. Zwanzig Jahre Berlin in zwanzig Minuten, eine Motorradfahrt entlang der Veränderung.
Ich lasse die Untersuchungshaftanstalt Moabit hinter mir, die mit der Liste ihrer Insassen auch eine Geschichte dieser Stadt erzählt: von Rosa Luxemburg über Bommi Baumann bis zu Erich Mielke. Auf dem Mittelstreifen vor der Mauer malt eine junge Frau ein Herz in die Luft – in der obersten Etage des Gebäudes hinter der Mauer schaut ein Mann durch die vergitterten Fenster.
Ich fahre am Edelrestaurant „Paris – Moskau“ vorbei, an dessen Fassade ein Transparent das 25-jährige Jubiläum verkündet – das ist wohl das, was man einen richtigen Riecher nennen muss: Fünf Jahre vor dem Mauerfall an diesem entlegenen Winkel der Welt ein Nobelrestaurant zu eröffnen, das nun in Fußweite von Parlaments- und Regierungssitz liegt.
Links winkt der Hauptbahnhof, der aussieht wie ein gelandetes Ufo, rechts das Kanzleramt mit seinen kubischen, runden, verschachtelten Formen, die irgendwas von Innen und Außen und Transparenz erzählen sollen – also wenig von politischer Realität. Wie eine Disney-Landschaft kommen mir diese modernen, ins Nichts geklotzten Bauwerke vor, wie ein Themenpark „Futurismus“. Und wer weiß, in ein paar tausend Jahren werden Touristen vielleicht die Rudimente des Regierungsviertels besichtigen wie die Athener Akropolis oder das Forum Romanum in Rom.
Die Straße schlängelt sich an Schweizerischer Botschaft, Paul-Löbe-Haus und Reichstag vorbei, der zu Mauerzeiten nicht mehr war als ein funktionsloses Gebäude aus dem Geschichtsbuch: Auf der Wiese davor haben wir Fußball gespielt, ansonsten diente das Gebäude als Kulisse für skurrile Konzerte – die Pudhys, Nina Hagen und Michael Jackson haben hier gespielt. Drinnen trafen sich die Bundestagsfraktionen auf Berlin-Trip zu symbolischen Sitzungen, eine Dauerausstellung stellte „Fragen an die Deutsche Geschichte“, die ein paar Meter hinter dem Gebäude ihre Antwort fanden.
Ich biege auf die Straße des 17. Juni ein – wie Horst Buchholz in „Eins, zwei, drei“ komme ich mir hier immer vor, wenn er mit seinem Motorrad auf das Brandenburger Tor zufährt. Kurz hinter der Stelle, wo er den Warnhinweis „You are leaving the american sector“ passiert, biege ich ab und fahre an der Amerikanischen Botschaft vorbei. Wie in einem Freilichtmuseum reihen sich Brandenburger Tor, US-Botschaft und Holocaust-Mahnmal aneinander, so als stünden hier die Determinanten der jüngeren deutschen Geschichte Spalier.
Weiter vorne streckt der Potsdamer Platz seine Arme aus, und wenn es stimmt, dass Berlin „arm, aber sexy“ ist, wie unser Bonmot-Bürgermeister behauptet, dann ist es hier protzig und unattraktiv. Einer dieser gesichts- und geschichtslosen Orte des neuen Berlin, die auch in Paris oder Rom liegen könnten – eben so, wie sich Architekten und Investoren aus der Provinz eine Weltstadt vorstellen.
Ein paar Scientologen werben um Opfer, Rikschafahrer warten auf Kunden, Touristen bestaunen ein paar Segmente der historischen Mauer, die sich unter den in den Himmel wachsenden Häusern geradezu lächerlich ausnehmen. Und davon hat irgendwer sich abhalten lassen?
Ich frage mich, wo unser Zelt gestanden hat, damals, im Sommer 88. Als Westberliner Umweltschützer ein Stück Brachland besetzten, das auf der Westseite der Mauer lag, aber zum Osten gehörte. Mit einem Dorf aus Hütten und Zelten protestierten wir gegen den Bau einer Autobahn, der drohte, wenn die Brache in das Eigentum West-Berlins überging. Stand unser Zelt unter dem Bahn-Tower? Dem Sony Center? Den Potsdamer Platz Arkaden? Und wo hat das zum Techno-Club umfunktionierte unterirdische Pissoir sich befunden, in dem wir vier Jahre später Silvester gefeiert haben – als diese steingewordene Weltstadtphantasie noch eine Wüste war? Als die Clubs noch Adressen statt Namen hatten oder wie ihre ehemalige Bestimmung hießen: Obst und Gemüse, E-Werk, Friseur? Es ist nicht mehr nachzuvollziehen. Ein paar Jahre später dirigierte Daniel Barenboim hier sein Ballett der Kräne, und verkaufte cleveres Stadtmarketing Baustellen als Sehenswürdigkeiten. Heute sind die Baulücken geschlossen und die Brachen bebaut, der Wildwuchs weitestgehend gezähmt. In den 90ern fand die Nachkriegszeit in Berlin auch ihr städtebauliches Ende.
Ich biege in die Niederkirchnerstraße ein und fahre ein Stück an der Mauer entlang, deren Verlauf mich hier immer etwas irritiert, weil ich vom Westen durch den Osten in den Westen fahre. Auf der ehemaligen Westseite: der Martin-Gropius-Bau; im ehemaligen Osten: der Preußische Landtag. Ich muss an Wowereit, Momper und Diepgen denken, an 25 Jahre Berliner Bürgermeister – merkwürdig, dass die Westberliner Provinzialität ausgerechnet hier überlebt hat. Als hielten sich die Berliner an ihren Politikern fest wie an einem Rettungsring in stürmischen Zeiten.
Weiter geht es in die Kochstraße, am weltberühmten Checkpoint Charlie vorbei, der uns zu Mauerzeiten so wenig interessiert hat wie die Mauer selbst. Nie sind wir auf eine der Aussichtsplattformen gestiegen, um nach drüben zu schauen. Die Mauer war für uns nicht mehr als das Ende einer Sackgasse, in die man geriet – nur dass in allen Richtungen Sackgassen waren, was Berlin zu einer riesigen verkehrsberuhigten Spielstraße machte.
Vorbei geht’s an der taz und – nur einen Steinwurf entfernt – dem Axel-Springer-Hochhaus. Dass das jetzt in der Rudi-Dutschke-Straße liegt, ist natürlich ganz witzig (und offenbart den Sinn der Berliner für einen recht trockenen Humor), aber vielleicht auch nur ein Beleg für den Weg der Alt-Achtundsechziger in den Mainstream. Klar, dass Bild-Chef Kai Diekmann im Gegenzug auch Genossenschaftler der taz werden darf.
Es ist schon merkwürdig: Wenn man das Berlin von heute mit dem Blick von damals ansieht, so als wäre man nicht mit der Vespa, sondern mit einer Zeitmaschine unterwegs, dann wirkt es wie eine Zukunftsvision aus einem Seyfried-Cartoon: der Springer-Verlag sitzt in der Rudi-Dutschke-Straße, auf dem einst besetzten Lenné-Dreieck ragen Hochhäuser von Daimler, Sony und Deutscher Bahn in den Himmel, vor dem Reichstag gibt es eine U-Bahn-Station namens Bundestag.
Höchste Zeit, dass es ins gute alte Kreuzberg geht, wo die Nächte lang sind, die Geschäfte türkisch und die Grünen die stärkste Partei – das inzwischen aber auch nicht mehr so gut und alt ist wie früher. Lange hat sich Kreuzberg weggeduckt unter dem Wandel der Stadt, so als könnte man es übersehen. Doch in den vergangenen paar Jahren ist die Veränderung auch hier angekommen: Die Schlesische Straße, diese ausgestorbene Sackgasse am Ende West-Berlins, hat sich zu einer Partymeile mit Clubs, Cafés und Kneipen gewandelt. Es gibt Boutiquen und Bars, die man eher im schicken Mitte vermuten würde und die sich wie das „Molotow“ in der Oranienstraße nur mit ihrem Namen an das alte Kreuzberg ranschmeißen. An den Wochenenden verwandeln einheimisches Szenevolk und ausländische Partytouristen den Kiez mit der ehemaligen Postleitzahl 36 in einen riesigen Vergnügungsbezirk. Auf den Straßen hört man Amerikanisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch – und was die Spanier angeht, so kann man das Gefühl bekommen, dass Kreuzberg ihre Rache für Mallorca ist.
Mit den Szenebezirken verhält es sich in Berlin wie mit dem Raubbau: Wenn eine Gegend erschlossen und ausgenommen ist, zieht die Karawane weiter, bis auch der nächste Kiez mit Cafés, Clubs, Kneipen und Hostels planiert ist, und statt Szenevolk nur noch Prolls und Touristen kommen. Nach der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain und der Oranienburger in Mitte sind nun also die Wiener Straße und die O-Straße dran. Die Ausläufer ziehen sich über den Landwehrkanal bis nach Neukölln hinunter. Man muss nicht auf das Vorzeigeprojekt MediaSpree, die 02 World oder die erste Kreuzberger MacDonalds-Filiale schauen, um zu merken, das sich hier etwas tut. Im Grunde verhält es sich mit Kreuzberg wie mit Berlin: Die Stadt ist schneller, glatter, teurer, professioneller geworden – ähnlich einer Rockband, die es vom Insider-Tipp auf die Bühnen der großen Stadien geschafft hat und deren Image nun weltweit vermarktet wird. Berlin, so schreibt Tobias Rapp in seinem Buch „Lost and Sound“, sei die „Feier-Hauptstadt der westlichen Welt“.
Ich schwinge mich auf meinen Roller und fahre zurück – über Kochstraße, Potsdamer Platz, Straße des 17. Juni –, bis nach Moabit, wo die Namen der Kneipen auf -Eck oder -Stuben enden; wo es Schultheiß und Engelhardt gibt statt Tannenzäpfle und Becks; wo die größte Veränderung ist, dass ab und zu ein neues Telecafé eröffnet, während ein anderes schließt. Ob der Berlin-Boom irgendwann auch hier ankommen wird?
Manchmal habe ich Angst um Berlin, davor, dass diese Stadt nicht mehr meine ist. Doch dann denke ich: Diese Stadt hat so viel mitgemacht in den vergangenen Jahrzehnten – war Ausgangspunkt von Krieg und Empfänger der Quittung, hat Blockade, Teilung und Vereinigung erlebt –, sie wird auch diesen Hauptstadthype überstehen. Sollen sie uns ruhig weitere 10.000 Beamte und Provinzler schicken und von mir aus noch 100.000 spanische Touristen dazu, sollen sie die Baulücken schließen und die Brachen bebauen: Unkraut, denke ich, vergeht nicht – und das ist ein schöner Gedanke. Das Regierungsviertel im Rücken fahre ich vor der Justizvollzugsanstalt rechts, dann bin ich wieder zu Hause.
(2009)
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Last modified: 20.01.20, 13:07
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Juni | ||||||
Wie könnte ich Sie per Email erreichen? Ich heiße Omer...
hab ich jahrzehntelang meinen schuldkomplex abgearbeitet war 1987 zwei wochen...
für den Artikel sehr gut. Dennoch bleibt zu behaupten, die...
ist ja auch, daß in den Townhouses die Wohnungen plötzlich senkrecht statt...
bereit ist, großzügige Räume im historischen Bestand (etwas Dachräume)...
Schrank der Großeltern ziehen? Dann sind die Sachen auch...
Frankfurt gibt es ja das neue "Europaviertel", von mir...
übriggeblieben man erkennt an dem posting allzudeutlich dass nicht...
den schuh an selten so gelacht tolle polemik lsd...
wenn man aufgehört hat, das Kino-ABC nach Hitchcocks zu...
Juni 2011 im Babylon Mitte mit Live-Orgelbegleitung. Großartig!
leider beleuchtet auch ihr hier verfasster Artikel die Problematik nicht wirklich....
aber diesen nicht. Siehe die Beiträge oben. Ich bin überhaupt...
persönliches Nutzungsprofil des ÖR ist ziemlich überschaubar: Von selber eigentlich...
Ich kann Abhilfe schaffen, um die Angst vor Tellerrändern (und...
Ich kann GEZ-Steuern mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ihr Beitrag...
Zur "Verbeamtung": Das ist ja ebenfalls eines der Vorurteile...
nicht über die sagenhafte Programmvielfalt eines Qualitätsmediums auf, sondern, über...
15-Jährigen, der bei seiner "Grafitti-Kunst" erwischt wurde und nun...
dann in der Gesellschaft, die zumindest die undifferenzierte Kritik...
ich GEZ!" ist also nicht hilfreich und reichlich abgedroschen? Gleiches...
wie sie mir gefällt.. aus pipi langstrumpf,eine serie die ich...