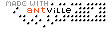Hier die Einleitung zu meinem neuen E-Book „O Jugend, o West-Berlin“, erhältlich in allen gängigen E-Book-Stores.
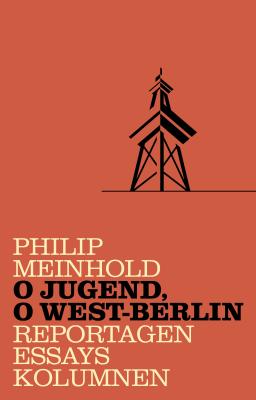
Meine erste Erinnerung an Berlin als Stadt – nicht an unsere Straße, den Spielplatz, den Weg zum Kindergarten, sondern an Berlin als Stadt mit eigenem Charakter – stammt von der Rückkehr von einer Urlaubsreise. Ich war wohl drei oder vier. Es war bereits dunkel, und wir fuhren über die Avus in die Stadt hinein – links die Zuschauertribüne der Avus, rechts das Motel, weiter entfernt der erleuchtete Funkturm. Das Gefühl, nach Hause zu kommen. Noch heute kann ich diese Verbindung von Heimat und Nacht, von Müdigkeit und Aufregung nachempfinden.
Ich glaube nicht, dass es nur an dem Wahrzeichen lag, das ich womöglich wiedererkannte, an dem Wissen: Gleich sind wir daheim. Wahrscheinlich lag es auch an der Transitstrecke und der Grenzkontrolle, die wir gerade hinter uns hatten. Wann man in West-Berlin war, war immer klar.
Diese Heimreise war gewissermaßen mein Initiationserlebnis als West-Berliner, ein Identitätsgefühl, das mich seitdem nicht verließ. „28 Jahre lang wuchs in West-Berlin eine Spezies heran, für die Vereinigung nichts mit ‚wieder‘ zu tun hatte“ , heißt es in diesem Buch. Meine ganze Kindheit und Jugend verbrachte ich hier – als ich achtzehn war, fiel die Mauer.
In den Texten dieses Buchs spüre ich der besonderen Atmosphäre jener Jahre nach, den Erinnerungen an ein „wunderbar unfertiges, unvollkommenes Berlin, das wie ein Auslaufplatz für Phantasien und Illusionen war“ . Ich erinnere mich an Eberhard Diepgen und die Deutschlandhalle, an Besuche auf der Grünen Woche und im Grips Theater, an die Junge Union und das Big Sexyland.
Dabei erfüllt dieses Buch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielleicht nicht mal auf Richtigkeit. Die Texte sind so, wie Erinnerungen nun mal sind: bruchstückhaft, sprunghaft und subjektiv – im besten Fall funktionieren sie wie ein Kaleidoskop, in dem aus bunten Scherben ein Bild der Vergangenheit entsteht.
Die meisten der hier versammelten Texte sind in den vergangenen 15 Jahren in verschiedenen Zeitungen erschienen – in taz und Frankfurter Rundschau, in brand eins oder Jungle World –, einige habe ich für diese Sammlung verfasst. Doch ich blicke nicht nur in die Vergangenheit, ich richte den Blick auch auf das Hier und Jetzt, die Differenz zwischen Damals und Heute: „Es ist schon merkwürdig: Wenn man das Berlin von heute mit dem Blick von damals ansieht, dann wirkt es wie eine Zukunftsvision aus einem Seyfried-Cartoon: der Springer-Verlag sitzt in der Rudi-Dutschke-Straße, auf dem einst besetzten Lenné-Dreieck ragen Hochhäuser von Daimler, Sony und Deutscher Bahn in den Himmel, vor dem Reichstag gibt es eine U-Bahn-Station namens Bundestag.“ Es ist interessant zu sehen, wie man selbst zum Zeitzeugen wird, wenn die Stadt, in der man lebt, sich Stück für Stück ändert.
Bei einigen der Texte wird der Leser bemerken, dass auch der einstige Gegenwartsbezug bereits wieder veraltet ist. Und so ist dieses Buch auch eine Bestandsaufnahme der Zeit seit dem Mauerfall, das Protokoll einer sich fortschreibenden Inventur dieser Stadt. „Wie hat sie ausgesehen, gerochen, sich angefühlt – vor zwanzig Jahren, als die Mauer noch stand? Vor fünfzehn Jahren, als die Stadt gebaut wurde, in der wir jetzt leben? Vor zehn Jahren, als die Bonner und Beamten kamen und in ihrem Gefolge die Medien, Konzerne, Kulturschaffenden? Berlin ist wie ein Gemälde, das die ersten Pinselstriche enthält, sie gleichzeitig aber nicht preisgibt.“
Der Autor und Filmemacher Alexander Kluge hat mal erklärt, dass nicht nur Menschen Lebensläufe besäßen, sondern auch Gegenstände und Gebiete. Die Biographie des Ruhrgebiets zum Beispiel umfasst laut Kluge etwa acht Generationen. Und so erzählt dieses Buch auch davon, wie die Biographie eines Menschen mit der seiner Stadt verknüpft ist – und die Biographie der Stadt mit der ihrer Bewohner; wie das eine das andere bedingt. „Was, wenn nicht die Summe unserer Erinnerungen macht uns aus?“ , heißt es in einem Text dieses Buchs. „Was macht uns zu denen, die wir sind?“Vielleicht ist Heimat deshalb so wichtig für uns – und vielleicht hat das der vierjährige Junge, der damals auf der Avus mit seinen Eltern in die Stadt hineinfuhr, auf eine wortlose Art erstmals begriffen.
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Ich habe schon verschiedentlich versucht, mich mit Texten bei den richtigen Leuten unbeliebt zu machen: Ich habe Frei.Wild beschimpft, gegen Harald Martenstein polemisiert; die Fans der Band BossHoss haben mal zum Boykott der taz aufgerufen – was vermutlich nicht allzu viele Abos gekostet hat. Umso überraschter war ich über die Resonanz, die meiner kleinen Polemik gegen den Holzmarkt am Spreeufer widerfuhr. Auf keinen anderen Artikel habe ich so viele direkte Reaktionen bekommen, von euphorischem Lob bis zu Beleidigungen. Gefreut habe ich mich dabei zugegebenermaßen über die Reaktion der Holzmarktmacher selbst, die mich zum Gespräch einluden. Er habe viel gelacht bei dem Artikel, schrieb mir Andreas Steinhauser, und es sei sicher auch einiges Wahres daran.
Also ab ins Kater Holzig, morgens um zehn, auf einen Kaffee mit Steini. Ein wenig aufgeregt bin ich schon, denn natürlich war mein Text nicht besonders nett (dies, liebe Kritiker, sind Polemiken nie!) – ob die mir heimlich Koks in den Kaffee schütten?
Steinhauser ist ein Mitvierziger in T-Shirt und Jeans, der viel in besetzten Häusern gewohnt habe, wie er erzählt – in Hanau, der Hafenstraße, in Berlin –; er ist seit zwanzig Jahren Mitglied im Chaos Computer Club, hat die Software-Schmiede Gate5 mitgegründet und an Nokia verkauft. Er hätte, wie er sagt, nie wieder arbeiten müssen. „Aber nicht zu arbeiten ist doch scheiße!“ Beim Holzmarkt ist er zuständig für das Gründerzentrum „Eckwerk“ und das Energiekonzept des Geländes.
Durch ein baufälliges Treppenhaus gelangen wir in ein Besprechungszimmer über dem Katerschmaus, auf dem Tisch ein paar leere Bierflaschen, an den Wänden Pläne. Steinhauser legt einen der Lagepläne auf den Tisch und erläutert mir das Projekt: das Eckwerk, den Möhrchenpark, die Hallen, die Hütten, den Club und das Restaurant. „Das derzeit interessante Projekt in Europa.“ Man dürfe nicht vergessen, was ansonsten mit dem Gelände passiert wäre, sagt er: ein Bauungetüm mit 83.000 qm² Bruttogeschossfläche und einem minimalen Uferweg – was sie verhindert hätten.
Er erzählt vom Blick auf den Sonnenuntergang aus dem Restaurant, von Tomaten auf den Dächern und einem Energiekonzept, das mit Wasser aus dem angrenzenden Wasserwerk gespeist werden soll, nur eine Schleife müsse man dort einbauen, um die vorhandene Wärme zu nutzen. Irgendwann ist er bei Städten mit selbstfahrenden Autos, die alle Parkhäuser und Staus verschwinden lassen.
Zwischendurch streckt Steini immer wieder seinen erigierten Mittelfinger in die Luft, zeigt ihn dem Immobilieninvestor Hinkel, der einen riesigen Appartementturm an das Spreeufer klotzt, oder den Möchtegern-Investoren, die auf dem verranzten Sofa der Holzmarktmacher Platz nehmen und jedem eine Million Euro bieten, wenn sie das Gelände weiter verkaufen.
Es gehe ihnen nicht um Rendite, sagt Steinhauser, sonst würden sie nicht so viel Freifläche lassen, und auch von ihnen persönlich werde keiner reich. Es gibt Menschen, die diesbezüglich anderes behaupten; ich kann das nicht nachprüfen, aber darum geht es auch nicht. Das Problem ist vielmehr ein grundsätzliches: In dem Rahmen, den die Stadtentwicklungspolitik lässt, sind wirkliche Alternativen nicht möglich. Grund und Boden, der eigentlich allen gehören sollte, wird nach kapitalistischen Kriterien verwertet (und natürlich gehört auch die Freifläche des Holzmarkts nicht allen, sondern ist das Privateigentum der Besitzer). Ich würde behaupten: Was Berlin nicht braucht, zumal am Ufer der Spree, ist ein weiteres Hotel oder Restaurant – auch wenn diese anders aussehen als das, was sonst dort so steht. Letztlich ist das eine Geschmacksfrage. Aber klar: Auch so ein Projekt wie der Holzmarkt muss sich finanzieren. Ohne Restaurant, Hotel und Club geht das nicht.
Und auch, wenn der Holzmarkt einiges anders macht und etliche Ideen recht sympathisch sind: Letztendlich bleibt er affirmativ beziehungsweise wird selbst zum Marketingargument für die Verwertung der Stadt. „Ist das Gentrifizierung?“, fragt Steinhauser und lehnt sich zurück. „Ja, wahrscheinlich ist das Gentrifizierung. Und natürlich treiben wir damit auch die Preise der Luxuswohnungen nach oben.“ Die Arme hinter dem Kopf verschränkt schaut er aus dem Fenster, er sieht dabei nicht besonders unglücklich aus.
Und so bleibt das Hauptproblem für mich eines der Selbstdarstellung – wie in dem Video zum Spatenstich: die Umdeutung des Holzmarkts zum revolutionären Akt, mit dem man die Stadt umkrempelt. Kein Hinterfragen der eigenen Rolle, zumindest öffentlich kein selbstkritisches Reflektieren. Das ist im Kern unpolitisch. Das Video, sagt Steinhauser, sei für die Zielgruppe gedacht gewesen; die sei halt nicht so politisch.
Ein Lackmustest für die Glaubwürdigkeit der Holzmarktmacher könnte sein, wie ernst sie es mit der Forderung „Spreeufer für alle“ selber nehmen – auch im Restaurant und im Club. In seinem Buch „Lost and Sound“ schreibt Tobias Rapp: „So bunt es aussieht: Es ist sozial doch recht homogen, wenn diese Ferndiagnose erlaubt ist. […] Das ist kein Einwand gegen das Treiben in der Bar 25, vielleicht aber einer gegen das Selbstbild vieler Gäste – so bunt und offen, wie der Laden sich anfühlt, ist er dann doch nicht. Seine Gäste sehen nur so aus.“
Dabei könnte es doch viel spannender sein, nicht nur mit Leuten zu feiern, die auf die gleiche Art verrückt sind, wie man selbst. Lasst die anderen Irren doch ebenfalls rein! Warum die Türpolitik des Clubs nicht so offen wie möglich gestalten? Warum im Restaurant nicht jeden Tag ein Gericht anbieten, das sich auch der Motz-Verkäufer leisten kann, wenn er will? Dies seien die einzigen zwei Orte, die nicht offen seien, räumt Steinhauser ein: „Der Club ist der Club, da kommt nicht jeder rein. Deswegen heißt es ja ‚Club‘. Das ist das Geschäftsmodell.“
Nun, mir persönlich sind andere Geschäftsmodelle sympathischer, denke ich und schaue ebenfalls aus dem Fenster. Ist der Holzmarkt nun besser als irgendein anderes Projekt? Ja, vielleicht ist er das. Er bringt ein bisschen Abwechslung in die Monotonie der Bebauung, und immerhin verfolgen hier ein paar Menschen eine Idee, die nicht nur auf Rendite beruht. Altruistisch sind sie deshalb noch lange nicht, auch nicht subversiv – sie tun das, weil sie Spaß daran haben. That‘s it! Das Grundproblem ändert der Holzmarkt ebenso wenig wie er ein Spreeufer für alle bietet.
„Und falls du mal nicht in den Club kommst, ruf mich an“, sagt Steinhauser, als ich mich nach anderthalb Stunden schließlich verabschiede. Das ist nett gemeint, ich weiß, aber – vielen Dank!
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Wir treffen uns in L.‘s neuer Wohnung in der Cuvrystraße in Kreuzberg, zwischen Schlesischer Straße und Spree. Das Haus befindet sich gleich rechts neben dem neuen Standort des Kjosk, diesem zum Café und Kramladen umgebauten Bus; beim Blick aus L.‘s Wohnzimmerfenster sind wir begeistert. Wie im Urlaub fühle man sich hier, befinden wir. Das liege am freien Blick und dem vielen Himmel, sagt F. Vielleicht auch am Blick auf das Wasser.
In jedem Fall ist es ein Blick, der Einiges über das Berlin des Jahres 2013 erzählt. Links die Spree, mit dem klotzigen nhow-Hotel auf der anderen Seite des Ufers und der Deutschlandzentrale von Universal, die wie so viele Medien und Konzerne Anfang des Jahrtausends nach Berlin gekommen ist. Daneben eine Reminiszenz an das alte West-Berlin: Eingezwängt zwischen zwei Gebäuden entdecke ich jenes Kunstwerk aus übereinander gestapelten Absperrgittern, das im Sommer 1987 am Ku‘damm stand. Es trägt den Titel „13.4.1981“ und erinnert an eine Demonstration, bei der 200 Schaufensterscheiben zu Bruch gingen. Vor dem Gitterturm wachte damals jeden Tag ein Berliner, der mit einem Schild um den Hals gegen diese Verschwendung von Steuergeldern demonstrierte. Als 16-Jähriger habe ich so manchen Nachmittag vor dem Kunstwerk verbracht und begeistert den Diskussionen gelauscht, die sich entsponnen.
K., die Kunst studiert hat, sagt, für sie sei es eines der besten Kunstwerke über Berlin – heute würde es allerdings auch Einiges über Universal erzählen. Denn genauso wie die Installation dort zwischen zwei Gebäude gepresst sei, gehe der Konzern mit seinen Künstlern um, die sich seinen Bedürfnissen anpassen müssten. Auf ungute Art ironisch ist es allemal, dass ausgerechnet eine Firma, die teure Immobilienprojekte entwickelt, die Arbeit dort aufgestellt hat. Das Kapital hat sich die Kunst einverleibt, das neue Berlin das alte.

Blick auf Universal und das nhow-Hotel, ganz links Olaf Metzels Kunstwerk „13.4.1981“
Direkt vor L.‘s Fenster befindet sich eine riesige Brache, deren rückseitige Brandwand von zwei haushohen Graffiti des Streetart-Künstlers Blu bedeckt sind: Da ist zum einen ein Mann mit Krawatte und Armbanduhren, die ihm mit einer Kette die Hände fesseln; zum anderen zwei Figuren, von denen eine Kopf steht, und die sich gegenseitig die Masken vom Gesicht ziehen. Die Finger der jeweils freien Hand sind zu einem E und einem W geformt, was für Eastside und Westside steht.
Auf der Brache vor den Bildern stehen einige heruntergekommene Zelte; ein Lagerfeuer brennt, Menschen sitzen beisammen. Von hier oben sieht das Camp wie ein internationales Punktreffen aus, das ein wenig aus der Zeit gefallen ist. L. erzählt, das Zelt ganz vorne am Ufer sei erst kürzlich dazugekommen; es gehöre einem Punk, der mit einem Rollkoffer kam.
Auf der Brache sollte einst ein Einkaufszentrum entstehen, im vergangenen Jahr dann das umstrittene Guggenheim Lab sein Quartier beziehen. Beides scheiterte an Protesten. Nun gibt es Planungen für Büros, Läden und Wohnungen, und wie diese aussehen könnten, davon zeugt das Haus ganz vorne am Wasser. Die riesigen Balkone lassen auf jene loftartigen Wohnungen schließen, wie sie in Berlin gerade an jeder Ecke entstehen.

Blick auf die Brache vorm Fenster
Der Blick nach rechts aus L.‘s Fenster schließlich führt zur Schlesischen Straße – in den Achtzigerjahren das Ende der westlichen Welt und auch in den Neunzigern halbwegs vergessen. Seit Mitte der Nullerjahre hat sich das geändert: Mit ihren Bars, Bistros, Clubs und Restaurants, deren Service erahnen lässt, dass man auf die Wiederkehr der Gäste nicht viel gibt, ist die Straße kaum wiederzuerkennen. Ein Laufsteg für Touristen und Partygänger.
L. berichtet, dass bei einem Freund, der in der Schlesischen Straße wohne, kürzlich mitten in der Nacht Spanier geklingelt hätten. Die Begründung: Sie hätten noch Licht gesehen. Wir lassen uns ein wenig über Touristen aus. K. erzählt von Stadtführungen auf ihrem Hof, F. ist froh, dass sie am Gesundbrunnen wohnt; da gebe es zwar keine Cafés, in die man gehen könne, aber dafür würde nachts niemand klingeln. L. kann dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen: Kürzlich habe sie unten auf der Straße ihr Rad repariert; das habe sich gut angefühlt zwischen all den Touristen. Nach dem Motto: Glotzt nur – ich lebe hier!
Im Grunde ist alles enthalten in diesem Blick aus dem Fenster: die hippen Medienkonzerne, die Lofts, die leicht verloren wirkenden Punks auf einer der letzten innerstädtischen Brachen. Das untergegangene West-Berlin, die Touristen, die Ausgehmeilen. Wie Zuschauer blicken wir durchs Fenster auf unsere Stadt, so als gehörten wir nicht dazu. Es ist irgendwie schrecklich und irgendwie schön – so schrecklich und schön wie Berlin.
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Last modified: 20.01.20, 13:07
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | ||||||
Wie könnte ich Sie per Email erreichen? Ich heiße Omer...
hab ich jahrzehntelang meinen schuldkomplex abgearbeitet war 1987 zwei wochen...
für den Artikel sehr gut. Dennoch bleibt zu behaupten, die...
ist ja auch, daß in den Townhouses die Wohnungen plötzlich senkrecht statt...
bereit ist, großzügige Räume im historischen Bestand (etwas Dachräume)...
Schrank der Großeltern ziehen? Dann sind die Sachen auch...
Frankfurt gibt es ja das neue "Europaviertel", von mir...
übriggeblieben man erkennt an dem posting allzudeutlich dass nicht...
den schuh an selten so gelacht tolle polemik lsd...
wenn man aufgehört hat, das Kino-ABC nach Hitchcocks zu...
Juni 2011 im Babylon Mitte mit Live-Orgelbegleitung. Großartig!
leider beleuchtet auch ihr hier verfasster Artikel die Problematik nicht wirklich....
aber diesen nicht. Siehe die Beiträge oben. Ich bin überhaupt...
persönliches Nutzungsprofil des ÖR ist ziemlich überschaubar: Von selber eigentlich...
Ich kann Abhilfe schaffen, um die Angst vor Tellerrändern (und...
Ich kann GEZ-Steuern mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ihr Beitrag...
Zur "Verbeamtung": Das ist ja ebenfalls eines der Vorurteile...
nicht über die sagenhafte Programmvielfalt eines Qualitätsmediums auf, sondern, über...
15-Jährigen, der bei seiner "Grafitti-Kunst" erwischt wurde und nun...
dann in der Gesellschaft, die zumindest die undifferenzierte Kritik...
ich GEZ!" ist also nicht hilfreich und reichlich abgedroschen? Gleiches...
wie sie mir gefällt.. aus pipi langstrumpf,eine serie die ich...