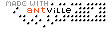Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, kurz ADS, ist gemeinhin etwas, was man bei kleinen Jungs und Heranwachsenden diagnostiziert. Doch seit Neuestem hat sich im deutschen Feuilleton und der artverwandten Publizistik eine Spielart der nervtötenden Krankheit verbreitet, die vor allem gutbürgerliche Männer um die Sechzig befällt.
Erste Anzeichen dieser gerontologischen ADS-Variante ließen sich vor ein paar Jahren bei den einstigen Großschriftstellern Walser und Grass erkennen, die mit antisemitischen Stereotypen in Wort und Schrift für mediale Aufregung sorgten. Ließen sich die Ausfälle damals noch als singuläre Vorkommnisse verwundert zur Kenntnis nehmen, so haben sie sich mittlerweile zu einer regelrechten Epidemie ausgewachsen. Deren auffälligstes Symptom: eine in Folge langjähriger medialer Präsenz erworbene Schlagzeilensucht, die in Verbindung mit den hyperaktiven Anteilen der Störung zu einer Schreib-Diarrhö in Form von Kolumnen, Büchern und Blogtexten führt.
Egal, ob Harald Martenstein, Matthias Matussek oder Reinhard Mohr: Wie Flitzer, die im Fußballstadion übers Spielfeld keilen, lassen die einstigen Feuilleton-Granden keine Gelegenheit aus, sich öffentlich selbst zu desavouieren, wobei sie auch der Verlust ihrer intellektuellen Rest-Reputation nicht schreckt. Bevorzugtes Thema ihrer geradezu aberwitzigen medialen Krawallsucht ist der Kampf gegen alles politisch Korrekte, sogenanntes „Gutmenschentum“ und „Gleichmacherei“.
So erklärte Matussek in einer selbstverständlich ironisch gemeinten Überschrift: „Ich bin wohl homophob, und das ist auch gut so“, während Reinhard Mohr angesichts der Diskussion um die Berliner Mohrenstraße in einer Radiokolumne argwöhnte: „Hilfe, mein Name ist nicht korrekt!“ Und Harald Martenstein greift sowieso dankbar jedes Thema auf, um von Blackfacing bis Frei.Wild gegen vermeintliche „Denkverbote“ anzuschreiben – was auf kuriose Weise mit der eigenen Denkfaulheit korreliert.
Bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Aufmerksamkeitshuberei scheint sich bekanntlich Thilo Sarrazin zu befinden, der mit „Deutschland schafft sich ab“ zwar das meistverkaufte Sachbuch nach 1945 schrieb und dem die Bild-Zeitung noch für jeden quersitzenden Furz eine Bühne bietet, was ihn jedoch nicht davon abhält, in seinem jüngsten wahndurchzogenen Werk „über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland“ zu schwadronieren.
Dabei weist die Ich-Bezogenheit der genannten Texte neben einer auf Schlagzeilen und Skandale geeichten Medienwelt auf eine weitere Ursache des multifaktoriell bedingten Störungsbilds hin: ein gerüttelt Maß an Eitelkeit der Betroffenen, geradezu mustergültig von Welt-Kolumnist Matussek vorgeführt, der in einer Entgegnung auf den Medienjournalisten Stefan Niggemeier den 15 Jahre jüngeren Kollegen zum publizistischen Schwanzvergleich lädt. Dabei zählt Matussek zunächst zeilengreifend seine beruflichen Stationen und medialen Großtaten auf – zwanzig Bücher, „davon drei Bestseller, die entschlossen quer zu Zeitgeist und Mode stehen, ferner Romane, Kurzgeschichten, TV-Formate“, und: „Jawoll, auch ich stehe in Unterrichtsbüchern“, weshalb sich auch niemand mehr über Deutschlands PISA-Ergebnisse wundern muss –, um sich gegen Ende des Texts schließlich selbst zu zitieren.
Mit der Eitelkeit einher geht offenbar die Kränkung des Alterns, weshalb Matussek nicht nur die LSD-Trips seiner Jugend erwähnt, sondern auch, dass er „alle möglichen Formen der Sexualität erprobt hat“ – wobei ihm die narzisstische Schreib-Onanie offensichtlich am meisten behagt.
Bleibt die Frage, wie sich der ADS-Befall der Alt-Feuilletonisten am besten eindämmen lässt: Sollte man es weiterhin mit der homöopathischen Verabreichung von Argumenten probieren, gegen die sich die Betroffenen meist immun erweisen? Oder warten, bis das Problem sich biologisch löst? Therapie erschwerend ist in jedem Fall, dass die Protagonisten aus ihren Provokationen ein einträgliches Geschäftsmodell machen konnten: So dürfte es Thilo Sarrazin mit seiner Sachbuch-Trilogie „Thilo gegen den Rest der Welt“ zum Millionär gebracht haben – während Harald Martenstein jedes noch so kleine Thema verwertet, das es auf die Tagesordnung einer Bezirksverordnetenversammlung schafft, um mit einem vermeintlichen Tabubruch halbwegs recherchefrei seine Kolumnen zu füllen.
Am wirksamsten wäre vermutlich eine Schocktherapie, bei der Medien und Öffentlichkeit die Betroffenen mit Aufmerksamkeit verschonen – was indes gar nicht so einfach ist. Es ist ein bisschen wie bei einem Autounfall: Man kann einfach nicht aufhören hinzusehen.
... Link (1 Kommentar) ... Comment
Die Kinostadt West-Berlin
Ein Sommerabend in Kreuzberg, anno 2012: Auf einem Hinterhof lümmeln etwa fünfzig Menschen auf Bierbänken und in Liegestühlen rum, an die Brandwand des Hauses wird ein Film projeziert: der Film-Noir-Klassiker „Kiss me deadly“. Die Vorstellung steht in keinem Kinoprogramm, der Eintritt ist frei, das Bier wird aus der Kneipe gegenüber geholt. Was wie eine Szenerie aus der Nachkriegszeit wirkt, bei der junge Menschen einen Kinoabend improvisieren, lässt sich auch als Symptom einer Entwicklung deuten. Wie Unkraut, das durch die Fugen der Betonplatten bricht, suchen sich die Freunde des abseitigen Films ihren Platz.
Dabei war Berlin immer Kinostadt: Fast 400 Lichtspielhäuser gab es hier vor rund hundert Jahren – Kinopaläste mit luxuriösen Zuschauerräumen, riesigen Leinwänden und noblen Foyers. „Die großen Lichtspielhäuser in Berlin sind Paläste, sie schlicht als Kinos zu bezeichnen wäre despektierlich!“, schrieb die Frankfurter Zeitung 1926. Das größte Kino der Stadt war mit 1800 Plätzen das Universum am Ku‘damm, in dem heute die Schaubühne residiert; im Gloria-Palast wurde der weltweit erste Tonfilm gezeigt. Auch das älteste noch betriebene Kino Deutschlands findet sich in Berlin: Seit 1907 gibt es das Moviemento am Kottbusser Damm, in einem Wohnhaus in der ersten Etage. In den Achtzigern arbeitete Tom Tykwer hier als Filmvorführer, später gestaltete er das Programm.
Und auch meine cineastische Sozialisation lässt sich anhand der Kinos West-Berlins erzählen: Im Zehlendorfer Bali sah ich mit „Mary Poppins“ meinen ersten Film; als ich zwölf war, fuhr ich sonntags regelmäßig ins Thalia in Lankwitz, um Elvis-Filme zu gucken. Mit dreizehn begann ich mit einem Freund, die Filme Alfred Hitchcocks zu sammeln. Nicht auf Video, geschweige denn DVD, sondern indem wir sie sahen. Wir besaßen jeder einen Bildband mit Fotos und Texten zu Hitchcocks Filmen, im Inhaltsverzeichnis vermerkten wir jeden gesammelten Film mit einem Bleistiftpunkt hinter dem Titel. Das Ziel: 57 Punkte.
Es gab noch keine gut sortierten Videotheken, erst recht kein Internet – und im Fernsehen nur fünf Programme. Alle zwei Wochen durchforsteten wir die Filmübersicht der Stadtmagazine auf der Suche nach neuen Hitchcocks. Die Chancen standen nicht schlecht. Berlin war ein Off-Kino-Eldorado, mit Klein-, Kleinst- und Kiezkinos jeder Couleur. Die zeigten Stumm- und Schwarz-Weiß-Filme, Kulthits und Randständiges, Perlen und echten Trash. Jedes Kino hatte sein eigenes Profil. Das Wilmersdorfer Eva zeigte den ortsansässigen Bildungsbürgern zwei Jahre lang den Oscar-prämierten Film „Amadeus“ (nur sonntags zur Matinee liefen, vermutlich den Wilmersdorfer Witwen zuliebe, Heimatfilme aus der Nazizeit); das Weddinger Alhambra zeigte jahrelang „Wedding“. Jedes Wochenende gab es in den verschiedensten Kinos „Lange Nächte“: Im Manhattan, in der Kulturwüste des Märkischen Viertels, sahen wir eine lange Woody-Allen-Nacht, im Weddinger Sputnik zehn Stunden Sergio Leone am Stück. Es gab John-Carpenter-Doppel und Marx-Brothers-Dreier – und im Moviemento-Vorgänger Tali Samstag für Samstag „Die Rocky Horror Picture Show“.
Unsere Sammelleidenschaft führte uns in die entlegensten Winkel der Stadt und an die abwegigsten Orte. Im Smokie im Ku‘dammeck durfte man rauchen, im Studio am Adenauerplatz gewöhnten wir uns das Kaffeetrinken an: Hier gab es zu den Filmen kostenlosen Kaffee. Im Hausprojekt KOB wurden über Beamer Filme mit Fernsehlogo in der Ecke auf die Leinwand geworfen; an der improvisierten Kasse gab es neben Schokoriegeln und Becks auch rauchfertige Joints zu kaufen. Im Schwulentreff Aha saßen wir eingeschüchtert auf versifften Sofas – wir wollten schließlich nur einen Hitchcock-Film sehen!
Mitte der Achtziger dann ein seltener Glücksfall: Fünf Hitchcock-Filme kamen in restaurierter Fassung ins Kino, nachdem sie jahrzehntelang nicht gezeigt worden waren. Im Saal 1 des Zoo-Palastes sahen wir „Vertigo“; im Foyer des Gloria-Palastes traten wir in einen Sitzstreik, weil man uns „Cocktail für eine Leiche“ nicht sehen lassen wollte, freigegeben erst ab 16 Jahren.
Das Aufstöbern nicht gesehener Hitchcock-Filme wurde mit fortschreitender Sammlung naturgemäß schwerer. In der Filmübersicht der Stadtmagazine wurden wir immer seltener fündig, nur das selten aufgeführte Frühwerk fehlte uns noch. Die Entwicklung der Kinolandschaft tat ein Übriges. Aus dem kleinen Alhambra wurde ein vierstöckiges Multiplex, das das Weddinger Prekariat mit Massenware und Popcorn in Eimern versorgt; kleinere Kinos wie Kurbel, Filmkunst 66 und Studio machten nach und nach dicht. Von den ehemals 22 Kinos am Ku‘damm – bis 1998 die Gegend mit der höchsten Kinodichte in Deutschland – haben ganze zwei überlebt. Im Gloria-Palast residiert Benetton, im Marmorhaus Zara, und in der Film-Bühne Wien, in der ich als Kind einst das „Dschungelbuch“ sah, öffnete kürzlich ein Applestore.
Natürlich ist das Angebot an Kinos in Berlin nach wie vor vergleichsweise gut: Es gibt Filmtheater, in denen Originalfassungen laufen; es gibt unabhängige Kinos, in denen man Raritäten sehen kann. Im Kreuzberger Regenbogenkino läuft eine lose Filmreihe mit dem Titel „Blick in die Filmgeschichte der 60er Jahre“, das Eva in Wilmersdorf zeigt sonntags immer noch alte deutsche Filme – die Wilmersdorfer Witwen sterben nicht aus. Doch es sind nur noch eine Handvoll Kinos, die sich so etwas leisten. Selbst die Filmauswahl der Arthouse-Kinos ist geringer geworden, weniger fragmentiert und verschroben. Die Kinolandschaft spiegelt die Entwicklung der Stadt: Die Mieten steigen, der Mainstream macht Druck, der Platz für Nischen wird enger. Allmählich muss ich mich wohl an den Gedanken gewöhnen, dass ich die wenigen Hitchcock-Filme, die mir noch fehlen, nicht mehr sehe.
Aber wer weiß: Vielleicht wird an einem jener improvisierten Filmabende auf einem Kreuzberger Hinterhof demnächst ja „Waltzes from Vienna“ oder „Blackmail“ gezeigt. Dann könnte ich zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren wieder einen Bleistiftpunkt in mein Hitchcock-Buch machen. Allen Multiplexen zum Trotz.
Dieser Text stammt aus dem E-Book „O Jugend, o West-Berlin“.
... Link (2 Kommentare) ... Comment
Der folgende Text stammt aus dem E-Book „O Jugend, o West-Berlin“.
„Berliner Entscheidungsfindung!“ Uli aus München schüttelte genervt den Kopf. Eine halbe Stunde schon standen wir klappernd vor Kälte an der Straßenecke und beratschlagten, wo wir jetzt hingehen sollten. Ins Café M? Da fanden wir sowieso keinen Platz. Ins Behrio? Ganz nett, aber zu wenig Frauen – und wir wollten uns wenigstens die Illusion bewahren, die Frau unseres Lebens zu treffen. In die Mutter? Kein vernünftiges Fassbier, nur das Scheiß-Scherdel, und dann auch noch viel zu teuer.
Für uns war es das samstägliche Eckensteh-Ritual, für meinen Münchener Besuch eine typische Berliner Eigenheit: die Unfähigkeit, sich kurz und knackig auf ein Café zu einigen. Dabei hatte es durchaus Zeiten gegeben, als das noch ging. Und dass es nun anders gekommen war, daran war einzig und allein die Rockerbraut Schuld.
Etwa zehn Jahre war es jetzt her, dass wir das Café Lux entdeckt hatten. Luxi, wie wir es schon bald liebevoll nannten. Für uns, frisch-examinierte Abiturienten, war das Lux eine Gottesgabe: cool genug, um sich dort sehen zu lassen, aber nicht so cool, dass wir uns darin uncool vorkamen. Die Wände bestanden aus rohen Ziegeln, im Zigarettenautomaten gab es P&S statt HB. Durch die Glasfront konnte man auf die Goltzstraße sehen, den Laufsteg der Schöneberger Szene. Wir saßen auf der roten Lederbank an der Wand, tranken Becks aus der Flasche, rauchten P&S, und wenn der Käsestangen-Verkäufer seine am Korb befestigte Klingel betätigte, rissen wir jubelnd die Arme hoch und schrien „Jawoll!“ und „Hurra!“.
Das Lux wurde Ausgangs- und Endpunkt unserer Abende – wobei wir es zwischen den beiden Punkten meistens gar nicht verließen. Für einen Ortswechsel hatten wir zu viel zu besprechen. Wir diskutierten, welches das beste Dijan-Buch sei und ob ein Comeback der Clash wünschenswert wäre. Wir stritten über die Vorzüge der verschiedenen Elemente des Haribo-Mixes – Frösche, Lakritzstangen und Spiegeleier –, und darüber, ob man es in zehn Jahren schaffen könne, Claudia Schiffer zu poppen. „Nie im Leben“, sagte Boris, „wie willst du denn rankommen an die?“ Rühle war anderer Meinung: „Wenn man alles andere diesem Ziel unterordnet, kannst du‘s schaffen! Du kannst eine Biographie über sie schreiben und sie so kennenlernen oder dich mit ihrem Gärtner befreunden. Wenn du es wirklich willst, kriegst du jede.“ – „Ach, und warum bist du dann seit zwei Jahren Single?“ – „Weil ich lieber mit euch im Luxi abhänge, du Spast.“ Nirgendwo konnte man Nichtiges so wichtig besprechen wie hier.
Wahrscheinlich würden wir noch heute so sitzen, das neueste Dijan rezensieren, darauf warten, dass The Clash reüssieren – wenn nicht eines Tages die Rockerbraut aufgetaucht wäre. Die Rockerbraut war die neue Bedienung. Sie trug Sekretärinnen-Brille und Rockröhren-Outfit, Cowboystiefel und kneifenge Jeans. Doch wäre ihr Äußeres noch zu ertragen gewesen, so war es ihr Musikgeschmack nicht: Als gälte es, einen Tanztee für alternde Hells Angels auszurichten, beschallte sie uns mit Aerosmith, Bryan Adams und Kiss. Anfangs versuchten wir noch, es mit Humor zu nehmen. Wir malträtierten unsere Luftgitarren und riefen: „Wir haben ja nichts gegen eine gepflegte Beatmusik.“ Unser einschränkendes „Aber“ wurde bereits vom nächsten Gitarrensolo verschluckt. Bald aber begannen wir durch die Fensterfront zu lugen, bevor wir das Luxi betraten. Wenn die Rockerbraut Tresendienst hatte, sagten wir: „Der DJ stimmt nicht“, und schlichen bedröppelt von dannen. Wer wollte von den Clash reden, wenn die Scorpions heulten? Wer Claudia Schiffer erwähnen, wenn Tina Turner rockte?
Wir mussten uns immer öfter schleichen. Die Rockerbraut hatte fast täglich Dienst, und irgendwann hieß es, sie habe das Lux übernommen. Im Hinterzimmer stellte sie einen Billiardtisch auf; bei der Metamorphose zum Musikcafé fehlten nur noch der Sand auf dem Boden und die Plastikpalmen. Wir gingen an unserer alten Liebe wie an einer verflossenen vorbei: Man weiß, dass es schön war, aber man versteht es nicht mehr; man kann nicht mehr nachvollziehen, was man einst an ihr fand.
Und als ich kürzlich das Luxi passierte, da war es gar nicht mehr da: Ein Yuppie-Café namens „Trüffel“ residiert nun in den Räumen; die Rockerbraut hatte das Lux zu Grunde beschallt. Zwar konnte ich mir ein grimmiges Lächeln nicht verkneifen, doch dieses Lächeln gefror mir schon bald im Gesicht. Am nächsten Wochenende standen wir klappernd vor Kälte mit Uli an der Ecke und überlegten, ob wir ins M, das Behrio oder die Mutter gehen sollten. Man hatte uns die Heimat genommen.
(2001)
... Link (0 Kommentare) ... Comment
Last modified: 20.01.20, 13:07
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni | ||||||
Wie könnte ich Sie per Email erreichen? Ich heiße Omer...
hab ich jahrzehntelang meinen schuldkomplex abgearbeitet war 1987 zwei wochen...
für den Artikel sehr gut. Dennoch bleibt zu behaupten, die...
ist ja auch, daß in den Townhouses die Wohnungen plötzlich senkrecht statt...
bereit ist, großzügige Räume im historischen Bestand (etwas Dachräume)...
Schrank der Großeltern ziehen? Dann sind die Sachen auch...
Frankfurt gibt es ja das neue "Europaviertel", von mir...
übriggeblieben man erkennt an dem posting allzudeutlich dass nicht...
den schuh an selten so gelacht tolle polemik lsd...
wenn man aufgehört hat, das Kino-ABC nach Hitchcocks zu...
Juni 2011 im Babylon Mitte mit Live-Orgelbegleitung. Großartig!
leider beleuchtet auch ihr hier verfasster Artikel die Problematik nicht wirklich....
aber diesen nicht. Siehe die Beiträge oben. Ich bin überhaupt...
persönliches Nutzungsprofil des ÖR ist ziemlich überschaubar: Von selber eigentlich...
Ich kann Abhilfe schaffen, um die Angst vor Tellerrändern (und...
Ich kann GEZ-Steuern mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ihr Beitrag...
Zur "Verbeamtung": Das ist ja ebenfalls eines der Vorurteile...
nicht über die sagenhafte Programmvielfalt eines Qualitätsmediums auf, sondern, über...
15-Jährigen, der bei seiner "Grafitti-Kunst" erwischt wurde und nun...
dann in der Gesellschaft, die zumindest die undifferenzierte Kritik...
ich GEZ!" ist also nicht hilfreich und reichlich abgedroschen? Gleiches...
wie sie mir gefällt.. aus pipi langstrumpf,eine serie die ich...